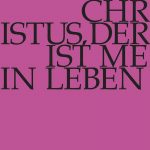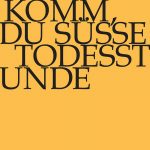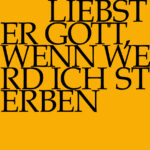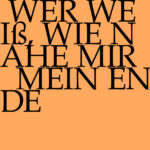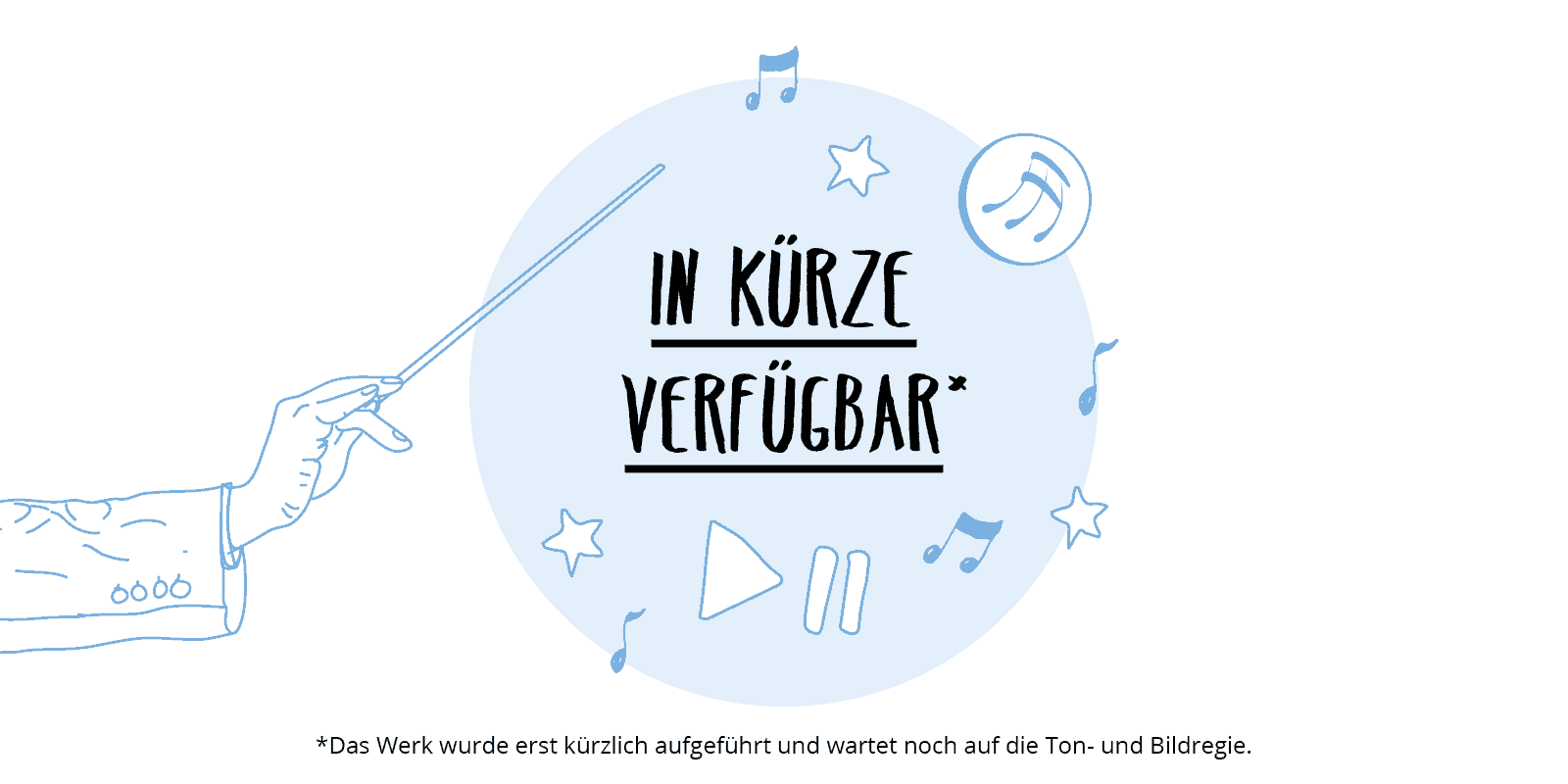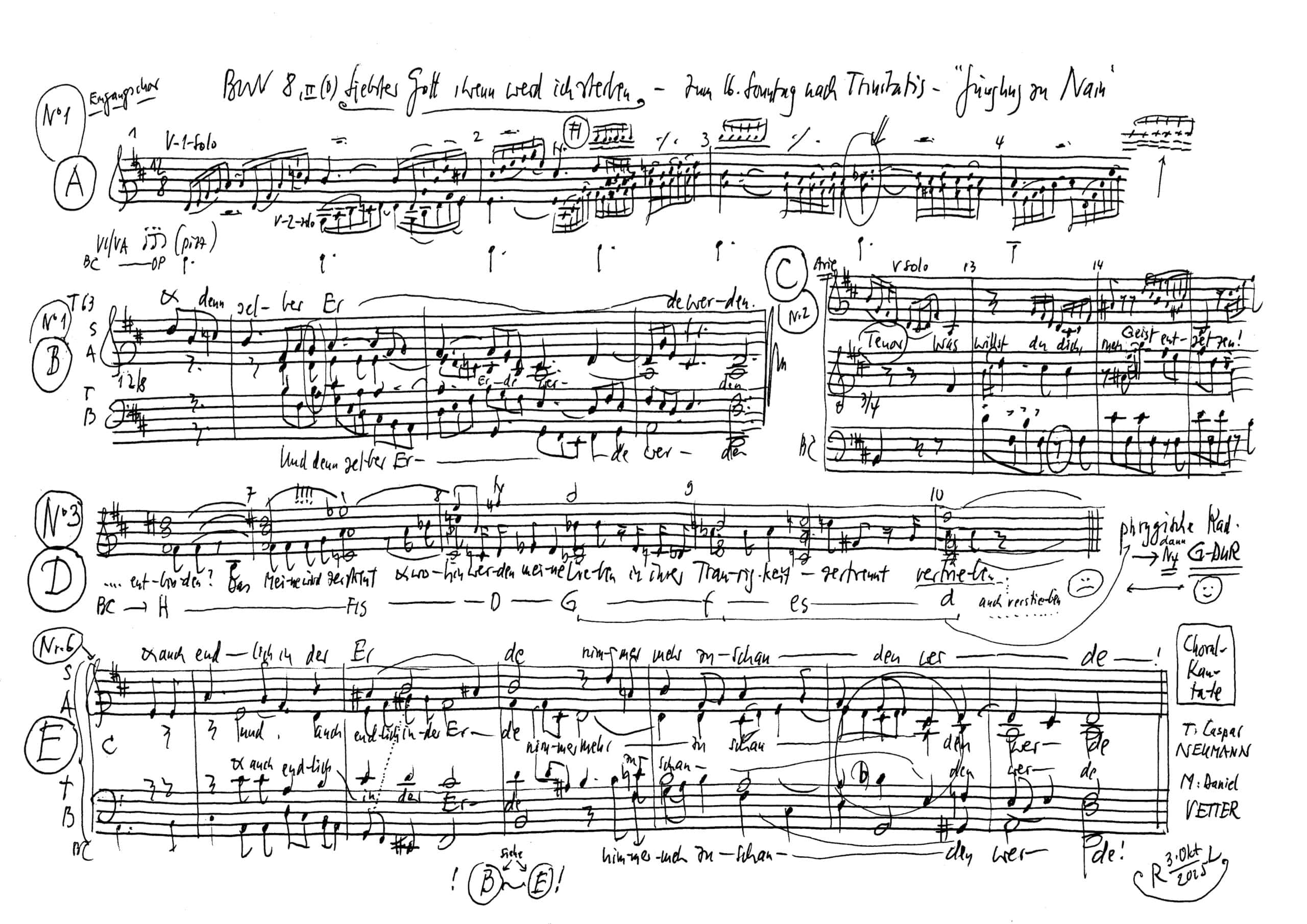Liebster Gott, wenn werd ich sterben
BWV 008 // zum 16. Sonntag nach Trinitatis
2. Fassung in D-Dur, für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Traversflöte, Oboe I+II, Taille, Violino concertato I+II, Streicher und Basso continuo
Mit den Themen Tod und Sterben sind die meisten Bach-Kantaten in irgendeiner Weise verknüpft. Selten jedoch gerät dies so abbildlich und berührend wie in seiner 1724 zum 16. Sonntag nach Trinitatis komponierten Choralkantate BWV 8. Ihr vom Ticken der Lebensuhr und vom Läuten der Sterbeglocken inspirierter Eingangschor changiert zwischen gespenstischem Memento mori und vertrauensvoller Geborgenheit. Die ausdrucksstarken Arien und Rezitative machen hingegen die Bewältigung der Todesangst zu einem Körper und Geist befreienden Erlebnis.
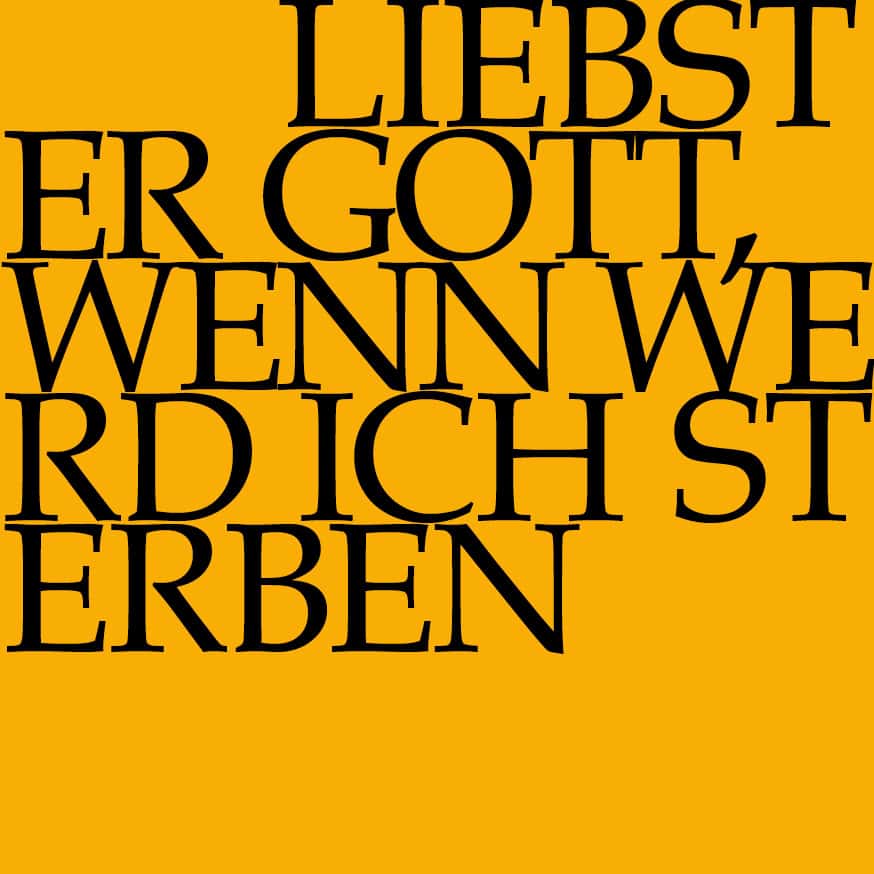
Das Werk im Kirchenjahr
Perikopen zum Sonntag
Perikopen sind die biblischen Lesungen zu den Sonn- und Festtagen im Kirchenjahr, für die J. S. Bach komponierte. Weitere Infos zu Perikopen
Herr, Gott, du bist unsre Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst: «Kommt wieder, Menschenkinder!» Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. – Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.
Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet um meiner Trübsale willen, die ich für euch leide, welche euch eine Ehre sind. Derhalben beuge ich meine Kniee vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heisst im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet werdet, auf dass ihr begreifen möget mit allen Heiligen, welches da sei die Breite.
Chor
Sopran
Stephanie Pfeffer, Jennifer Ribeiro Rudin, Noëmi Sohn Nad, Mirjam Wernli, Ulla Westvik
Alt
Anne Bierwirth, Antonia Frey, Laura Kull, Francisca Näf, Simon Savoy
Tenor
Marcel Fässler, Clemens Flämig, Tobias Mäthger, Tiago Oliveira
Bass
Fabrice Hayoz, Johannes Hill, Grégoire May, Peter Strömberg, William Wood
Orchester
Leitung
Rudolf Lutz
Violine
Éva Borhi, Péter Barczi, Christine Baumann, Judith von der Goltz, Petra Melicharek, Ildikó Sajgó, Lenka Torgersen, Aliza Vicente
Viola
Martina Bischof, Lucile Chionchini, Matthias Jäggi
Violoncello
Maya Amrein, Daniel Rosin
Violone
Guisella Massa
Traversflöte
Daniela Lieb
Oboe
Philipp Wagner, Katharina Arfken
Fagott
Susann Landert
Taille
Josefa Winterfeld
Cembalo
Thomas Leininger
Orgel
Nicola Cumer
Musikal. Leitung & Dirigent
Rudolf Lutz
Werkeinführung
Mitwirkende
Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter
Reflexion
Reflexion
Anna-Magdalena Elsner
Aufnahme & Bearbeitung
Aufnahmedatum
24.10.2025
Aufnahmeort
Trogen AR // evangelische Kirche
Tonmeister
Stefan Ritzenthaler
Regie
Meinrad Keel
Produktionsleitung
Johannes Widmer
Produktion
GALLUS MEDIA AG, Schweiz
Produzentin
J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz
Textdichter
Erste Aufführung
Erste Fassung in E-Dur am 24. September 1724 in Leipzig; zweite Fassung in D-Dur wahrscheinlich am 17. September 1747 in Leipzig
Textdichter
Strophen 1 & 6: Caspar Neumann, um 1690; Strophen 2-5: Umdichtungen eines unbekannten Verfassers
Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen
1. Choral
Liebster Gott, wenn werd ich sterben?
Meine Zeit läuft immer hin,
und des alten Adams Erben,
unter denen ich auch bin,
haben dies zum Vaterteil,
daß sie eine kleine Weil
arm und elend sein auf Erden
und denn selber Erde werden.
1. Chor
Die erste Strophe des Sterbeliedes von Caspar Neumann (1690) «Liebster Gott, wenn werd ich sterben?» macht das Proprium des 16. Sonntags nach Trinitatis mit den Perikopen Psalm 90 (Endlichkeitsbewusstsein) und Lukas 7,11-17 (Jenseitshoffnung – Auferweckung des Jünglings von Nain) zum Thema. Ersteres wird in der Schlusszeile auch kraftvoll benannt: «arm und elend sein auf Erden / und denn selber Erde werden». Während Bachs Neufassung unter Verzicht auf eine Hornstimme die Oboen als eigenen Chor zur Verdoppelung der Singstimmen ausgebaut hat, blieb die Grundarchitektur des Satzes bewahrt. Gezupfte Akkordbrechungen und Continuotupfer der Streicher sowie kreisende Gebetsgesten der Soloviolinen erzeugen zum wiegenden 12/8-Takt im sonst strahlenden D-Dur ein Klangbild beklemmender Unentrinnbarkeit, während die Sechzehntelschläge und wirbelnden Figuren der Traversflöte die ablaufende Lebensuhr evozieren.
2. Arie — Tenor
Was willst du dich, mein Geist, entsetzen,
wenn meine letzte Stunde schlägt?
Mein Leib neigt täglich sich zur Erden,
und da muß seine Ruhstatt werden,
wohin man soviel tausend trägt.
2. Arie — Tenor
Die Aussage der zweiten Strophe des Neumann-Liedes wurde beim Librettisten zu einer Frage: Weshalb sich über die eigene Endlichkeit entsetzen, wenn man doch um seine Sterblichkeit und die seiner Mitmenschen weiß? Wobei die letzte Zeile der Tenor-Arie in Neumanns Liedtext prägnanter und verständlicher war: «und schon mancher liegt im Grabe / den ich wohl gekennet habe». Während der pizzicato und staccato geführte Continuo für Kontinuität zum Eingangssatz sorgt, entfaltet die Tenorpartie eine elegische Kantabilität, die durch den Wechsel von der Oboe d‘amore (1724) zur Solovioline einen seidigen Vergänglichkeitston ausbildet.
3. Rezitativ — Alt
Zwar fühlt mein schwaches Herz
Furcht, Sorge, Schmerz:
Wo wird mein Leib die Ruhe finden?
Wer wird die Seele doch
vom aufgelegten Sündenjoch
befreien und entbinden?
Das Meine wird zerstreut,
und wohin werden meine Lieben
in ihrer Traurigkeit
zertrennt, vertrieben?
3. Rezitativ — Alt
Das Alt-Rezitativ spricht persönliche Furcht, Sorgen und Schmerzen angesichts des Todes und damit verbundene Fragen an: Was wird mit dem «Meinen» geschehen? «Wohin werden meine Lieben in ihrer Traurigkeit vertrieben?» Begleitet von einem ausdrucksstarken Streichergerüst durchlebt die Altstimme auch musikalisch ungewöhnlich trostfern ausgedeutete Momente tiefer Erkenntniseinsamkeit.
4. Arie — Bass
Doch weichet, ihr tollen, vergeblichen Sorgen!
Mich rufet mein Jesus, wer sollte nicht gehn?
Nichts, was mir gefällt,
besitzet die Welt.
Erscheine mir, seliger, fröhlicher Morgen,
verkläret und herrlich vor Jesu zu stehn.
4. Arie — Bass
Darauf antwortet die Bass-Arie mit einer klaren Ansage: «Weichet, ihr tollen, vergeblichen Sorgen!» Wenn Jesus rufe, wer wollte nicht willig gehen? Denn die Welt habe nichts Gutes zu bieten, und deshalb: «Erscheine mir, seliger, fröhlicher Morgen, verkläret und herrlich vor Jesu zu stehn.» Anders als im Eingangschor steht der animierte 12/8-Takt für die Entschlossenheit, dem eigenen Ende hoffnungsstark entgegenzutreten. Durch Hinzufügung einer Oboe d’amore hat Bach gegenüber der Version von 1724 den Concertato-Charakter des Satzes gestärkt.
5. Rezitativ — Sopran
Behalte nur, o Welt, das Meine!
Du nimmst ja selbst mein Fleisch und mein Gebeine;
so nimm auch meine Armut hin!
Genug, daß mir aus Gottes Überfluß
das höchste Gut noch werden muß;
genug, daß ich dort reich und selig bin.
Was aber ist von mir zu erben,
als meines Gottes Vatertreu?
Die wird ja alle Morgen neu
und kann nicht sterben.
5. Rezitativ — Sopran
Das Sopran-Rezitativ führt das Selbstgespräch der Arie weiter: «Behalte nur, o Welt, das Meine!» Nehme sie nur Fleisch und Gebeine, «so nimm auch meine Armut hin!» Es schließt mit der Gewissheit von Gottes «Vatertreu», denn diese werde «alle Morgen neu» und könne nicht sterben.
6. Choral
Herrscher über Tod und Leben,
mach einmal mein Ende gut,
lehre mich den Geist aufgeben
mit recht wohlgefaßtem Mut!
Hilf, daß ich ein ehrlich Grab
neben frommen Christen hab
und auch endlich in der Erde
nimmermehr zuschanden werde!
6. Choral
Der zu einer Melodie des früheren Leipziger Nikolaiorganisten Daniel Vetter ungewöhnlich arios gesetzte Schlusschoral fasst mit der letzten Strophe des Neumann-Liedes die Aussage der Kantate zusammen: Gott möge als «Herrscher über Tod und Leben» ein gutes, mutig hingenommenes Ende geben. Am Schluss steht die Bitte um ein «ehrlich Grab» und die indirekt formulierte Auferstehungshoffnung, dass man «auch endlich in der Erde nimmermehr zuschanden werde!»
Anna Magdalena Elsner
Meine Damen und Herren,
als ich eingeladen wurde, über die eben gehörte Kantate zu sprechen, habe ich mich wirklich gefreut. Und diese Freude kam – wenn ich ganz ehrlich bin – nicht primär daher, dass ich mich hier heute in einer etwas anderen Form als sonst in meinem Alltag mit Tod und Sterben beschäftigen darf. Die Freude war vielmehr eine sehr persönliche: Meine Eltern haben mir meinen Vornamen – Anna Magdalena – aus Liebe zu Bach gegeben. Nicht immer erfüllen sich ja die Hoffnungen, die Eltern in einen Namen legen. In meinem Fall aber ist es tatsächlich so gekommen: Der Name, den ich mit Bachs zweiter Frau teile, hat mir nicht nur einen besonderen Zugang zu seiner Musik eröffnet, sondern zugleich meine Aufmerksamkeit auf jene Frau gelenkt, die als Musikerin an seiner Seite, aber wohl auch in seinem Schatten stand. Beim Hören dieser Kantate tritt sie für mich aber ins Licht.
Im Entstehungsjahr der Kantate war Bach erst seit kurzem mit seiner zweiten Frau verheiratet. Schon bald darauf ereilte die Familie eine Reihe von Todesfällen: es starben viele der Kinder, Anna Magdalena musste im Laufe ihres Lebens sieben der dreizehn von ihr geborenen Kinder zu Grabe tragen – ein Schicksal, dessen Schwere wir uns kaum noch auszumalen vermögen. In einem solchen Leben, durchdrungen von Sterben und Trauer, erhält die Härte des irdischen Daseins, eine bedrängende Wirklichkeit.
Aber es ist nicht allein das Motiv des Sterbens, sondern auch das des Überlebens – der Überzeugung, dass es ein solches gibt und die Gelassenheit mit der darum die Schwere des Lebens hingenommen werden kann, das für mich untrennbar mit Anna Magdalena verbunden ist. Nicht nur überlebte sie ihren Mann und viele ihrer Kinder; in ihrer Rolle als Kopistin seiner Musik hat sie massgeblich dazu beigetragen, dass Bachs Musik selbst seinen Tod überlebt hat. In gewisser Weise reicht ihr stilles Werk daher bis in unsere Gegenwart – als unsichtbare Hand, die den Nachruhm ihres Mannes und den Fortbestand seiner Musik überhaupt erst möglich gemacht hat. So wurde sie als Übersetzerin Teil seiner Musik und dadurch auch Teil einer Kreativität, die eng mit Tod verknüpft war.
Zwischen Kantate und Kapsel
Und da wir von der Frau Cappellmeisterin nur relativ wenig Sicheres wissen, können wir uns viel vorstellen. So stelle ich mir vor, was ihr durch den Kopf gegangen sein mag, beim Kopieren einer Kantate, die vom Sterben handelt. Vielleicht hat sie als Sängerin die Kantate auch selbst mitgesungen. Durch diese mögliche Teilhabe verbindet sich ihre eigene Lebensgeschichte mit der des Werkes – und macht so eine grundlegende Frage spürbar, die schon in der Entstehung der Kantate angelegt ist: Wie kann man nach einem Verlust weiterleben – nicht nach irgendeinem, sondern nach dem Tod eines Kindes oder sogar der eigenen Kinder? Aus dieser Erfahrung der Trauer ergibt sich der gedankliche Schritt vom Tod des anderen zum Tod des Selbst, zur Frage nach dem eigenen Ende. In der Figur der Anna Magdalena Bach wird dieser Weg – vom Anderen zum Selbst – aus der Abstraktion herausgeführt und verdichtet sich zu einer elementaren, beinahe kindlich anmutenden und zugleich erschütternd existentiellen Frage: Wann werde ich sterben? Ja, vielleicht sogar, wann kann auch ich endlich sterben?
Für viele Menschen des 21. Jahrhunderts mag das Vertrauen in ein Leben nach dem Tod welches uns in der Kantate begegnet, befremdlich, ja unzugänglich wirken. Doch eigentlich entfaltet sich dies hier weniger als Gewissheit als ein Geflecht von Fragen: Wann wird meine Zeit gekommen sein? Woran werde ich dann denken? Wo werde ich beigesetzt werden – und was wird aus den Menschen, die ich zurücklasse? So begegnen wir nicht nur einem unerschütterlichen Glauben, sondern auch einem tastenden Ringen mit dem Ungewissen.
Ich kann nicht umhin diese Fragen auch in unserem gegenwärtigen medizinischen Kontext zu hören, wo das Wann unweigerlich in den Horizont der Patientenautonomie getreten ist. Heute verhandeln viele Länder, auch viele unsere Nachbarn, die Legalisierung der Sterbehilfe; die Schweiz ist das älteste Land, das sie unter bestimmten Voraussetzungen nicht verbietet. In Kanada, dem vielleicht liberalsten Sterbehilferegime der Welt, starb im Jahr 2023 jede zwanzigste Person durch Sterbehilfe; in der Provinz Québec waren es sogar noch mehr. Immer wieder stellt sich dabei die Frage, was in Zeiten radikaler Individualisierung überhaupt als gutes Ende gelten kann. In diesen Debatten geht es um vieles: um die Rolle der Medizin und der Gesellschaft, um Normen, um Autonomie und Würde, Begriffe, die sich letztlich in einem Punkt bündeln: in der eigenen Todesstunde. Es ist die vielleicht drängendste Frage terminal erkrankter Menschen an Ärztinnen, Ärzte und Pflegende: Wann werde ich sterben? Wie lange bleibt mir? Die Medizin kann hier zunehmend präzisere Antworten geben. Doch die Frage wandelt sich: Aus Wann werde ich sterben? wird Wann und Wo und Wie will ich sterben? – ja sogar: Wann und Wo und Wie soll oder sollte ich sterben? In dieser Verschiebung, die im Versprechen des selbstbestimmten Todes mündet, erscheint das Wann nicht länger als Geheimnis, sondern als Option – Ausdruck einer Wahlfreiheit. Diese Idee nimmt Gestalt an in der glänzenden Suizidkapsel Sarco im Schaffhauser Wald: Sinnbild einer säkularisierten Erlösung, in der die Medizin, die sich im zwanzigsten Jahrhundert vielerorts die Herrschaft über das Sterben angeeignet hat, nun bewusst ausgeklammert wird. Sterben auf Knopfdruck. an einem Ort, an dem man zum Sterben niemanden mehr braucht.
Im Angesicht des eigenen Sterbens
Ich möchte aber einen Schritt zurücktreten – zu der Möglichkeit überhaupt, die Frage Wann werde ich sterben? stellen zu können. Von der Kantate aus betrachtet führt dieser Rückschritt zugleich vorwärts: an den Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, zu einem Essay, der die Frage nach dem eigenen Sterbezeitpunkt umgekehrt hat – oder, anders gesagt, grundsätzlich bezweifelt, dass wir unser eigenes Sterben überhaupt denken können. In seinem kurzen Aufsatz «Zeitgemäßes über Krieg und Tod» (1915) – einem Text, der in den letzten Jahren leider wieder eine beunruhigende Aktualität gewonnen hat – schreibt Sigmund Freud:
«Der eigene Tod ist ja auch unvorstellbar, und so oft wir den Versuch dazu machen, können wir bemerken, dass wir eigentlich als Zuschauer weiter dabei bleiben. So konnte in der psychoanalytischen Schule der Ausspruch gewagt werden: Im Grunde glaube niemand an seinen eigenen Tod oder, was dasselbe ist: Im Unbewussten sei jeder von uns von seiner Unsterblichkeit überzeugt.»
Rational mag uns die Gewissheit unseres Todes zugänglich sein, doch in einem tieferen Sinne bleibt sie uns unvorstellbar. Das Leben selbst erfordert, die fortwährende Verdrängung dieser Gewissheit, da der Tod in unserem Unbewussten stets «nur die anderen» betrifft. Mit dieser Einsicht reiht sich Freud in eine philosophische Tradition ein, die auf die Unmöglichkeit verweist, das eigene Ende wirklich zu denken. Diese Perspektive mag uns heute, hier, auch jenseits aller Abstraktion plausibel erscheinen: Auch ohne Freuds Verdrängung, bleibt festzuhalten, dass sich die Bedingungen des Sterbens in westlichen Gesellschaften tiefgreifend verändert haben: Wir leben im Durchschnitt nicht nur erheblich länger, sondern das Sterben selbst – in der Schweiz verstirbt die Mehrzahl der Menschen in Alters- und Pflegeheimen oder in Spitälern – ist weitgehend aus der Alltagswelt in institutionelle Räume verlagert.
Ganz anders im Leipzig des 18. Jahrhunderts, wo der Tod näher, sichtbarer und meist auch schmerzhafter war – ohne Antibiotika, Morphium oder Palliativstation. Die Frage nach der Todesstunde war dort kein blosses geistiges Bedürfnis, sondern eine unmittelbare Erfahrung. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass der Tod heute keine Wirklichkeit mehr hätte, ja gar Tabuisiert wäre – im Gegenteil: Sterbenarrative in Literatur und Film haben Konjunktur, über Sprachen und Kulturen hinweg. Sie handeln von terminalen Krankheiten, von Einsamkeit, von der Inanspruchnahme von Sterbehilfe und scheinen selbst zu einem neuen Sterberitual geworden zu sein. Ein medikalisierter oder gar selbstbestimmter Tod ist nicht notwendigerweise ein leichterer, wohl aber ein ganz anderer.
Gemeinsam aber ist künstlerischen oft religiöse Zeugnissen vergangener Jahrhunderte und den zeitgenössischen Auseinandersetzungen mit dem Sterben, dass sie uns vor Augen führen: Die Gewissheit unserer Endlichkeit bleibt bestehen. Ungeachtet unserer unbewussten Fantasien vom ewigen Leben, der Unsterblichkeitsprojekte des Silicon Valleys oder der Tatsache, dass der Tod nur noch selten in unseren Häusern stattfindet – Sterben bleibt unser kleinster gemeinsamer Nenner, ob öffentlich oder verborgen, selbstbestimmt oder ausgeliefert. Der Tod ist nie wirklich fern.
Und oft machen diese künstlerischen Auseinandersetzungen – in einer Erinnerung, einem Satz, einem Bild, einer Geste – sogar das eigene Sterben in einem Moment unverdrängbar. Ich hatte eine tief gläubige Grossmutter. Eine meiner prägendsten Kindheitserinnerungen an sie ist eine lange Zugfahrt von Zürich an die Nordsee, während der sie mich lehrte, den Rosenkranz zu beten. Ich sehe uns noch im Abteil: die gleichmässige Bewegung ihrer Lippen, die Perlen zwischen ihren Fingern, das Murmeln der Gebete, das sich mit dem Rattern der Räder mischte. Ich erinnere mich an die Langeweile, die sich in der Litanei des langsam vorankommenden Zuges ausbreitete, an meine Zweifel, ob ich das, was ich da wiederholte, wirklich glaubte, und an die leise Scham, wenn andere Reisende die Tür öffneten, kurz innehielten und dann – vom Anblick von uns Betenden leicht befremdet – weitergingen. Aber wer hundertmal «jetzt und in der Stunde unseres Todes» wiederholt, verleiht dieser Stunde eine eigene, zunächst nur sprachliche Realität, die dann jedoch in der Wiederholung, im Atem, im Klang der Worte eine körperliche wird – der Tod schreibt sich so – Silbe für Silbe – ins Leben ein. Und während ich die Worte weiter murmelte, begann ich mir – fast unmerklich – diese Todesstunde auszumalen: mein eigenes Sterben – natürlich ohne Schmerzen, das laute Weinen derer, die um mein Bett stünden und mich vermissen würden (dabei stiegen mir selbst die Tränen hoch), den hölzernen Sarg, in dem ich mein schönstes Kleid trüge, das, welches mir meine Eltern auf einer Reise nach Paris gekauft hatten, und vorallem die wichtige Frage, wem ich wohl meine Kette aus echtem Gold vermachen würde.
Zur Erde hin geboren
Dieses kindlich-fromme Ausmalen meiner seligen Todesstunde verbindet sich für mich heute mit einem ganz anderen, radikal ernüchternden Bild– mit Samuel Beckett, der in Warten auf Godot den Menschen zeigt als ein Wesen, das «rittlings über dem Grabe» geboren wird. Und wenn Vladimir, einer der beiden Wartenden in Becketts Stück, dann sagt: «Von unten – aus der Grube heraus – legt der Totengräber zögernd seine Geburtszangen an», wird dieses Bild fast unerträglich plastisch und das Paradox des menschlichen Daseins unbarmherzig sichtbar: Geburt und Tod fallen ineinander, Anfang und Ende sind kaum zu unterscheiden. Beckett entwirft hier die totale Entzauberung meiner seligen Todesstunde.
Die Wucht dieses Bild lässt mich immer wieder erschaudern. Und doch zeigt sich darin –wie auch im jetzt und in der Stunde unseres Todes – dieselbe Wahrheit: Leben und Sterben gehören zusammen. Zugleich kehrt Beckett eine uralte Vorstellung ins Gegenteil: dass ein guter Tod vielleicht Teil eines guten Lebens sein kann. Diese reicht bis in die Antike zurück und findet in der mittelalterlichen Bild- und Texttradition der ars moriendi ihre Fortsetzung – jener «Kunst des Sterbens», die in Texten und Holzschnitten lehrte, dass innere Haltung und Vorbereitung der Schlüssel zu einem guten Tod sind.
Beim Hören der Kantate lässt mich Becketts Bild aber gerade darum nicht los, weil sich hier jener Wunsch nach einem guten Ende mit etwas ganz anderem verschränkt: mit Körperlichkeit und Materialität. Erde und Grab spielen hier eine zentrale Rolle: auf Erden sein, zu Erde werden – das Bild des sich langsam zur Erde neigenden Leibes. Wo Freud von psychischer Verdrängung spricht, drängt sich hier der menschliche Körper hervor: anfällig, zerbrechlich, verletzlich, erlaubt er keine Verdrängung, weil er sich von Geburt an zur Erde drängt. Wann werde ich sterben ist keine Frage, die wir in ihre Einzelteile zerlegen oder im leeren Raum stellen können, keine abstrakte Überlegung, denn ihr Ausgangpunkt ist immer ein lebender und damit immer auch schon sterbender Körper.
In ihrem bewegenden Buch Easy Beauty: Blicke auf meine Behinderung beschreibt die amerikanische Autorin Chloé Cooper Jones ihr Leben mit einer seltenen körperlichen Behinderung – dem Geborensein mit einer unvollständigen Wirbelsäule. Sie schreibt über Schmerz, über die Sichtbarkeit ihres anderen Körpers und darüber, wie dieser Körper, der sich zur Erde neigt, sie zwingt, sich anders durch die Welt zu bewegen: langsamer, tiefer, gebückter, mit mehr Rücksicht. Lange empfand sie das als Niederlage und versuchte, ihren Körper zu verbergen. Doch im vergangenen Jahr trat sie in einer Tanzperformance auf der New Yorker High Line mit dem bedeutsamen Titel Die No Die auf. Darin tanzt sie mit diesem, ihrem Körper, besonders in einer scheinbar einfachen Übung, die der Choreograf sie immer wieder machen ließ: den Kopf, den ganzen Körper auf die Erde zu legen. Widerstand, Loslassen, Hingabe – und schliesslich: Geborgenheit, Einssein mit der Erde, Demut. Diese Geste des sich niederlegenden Körpers ist für mich ein Bild des Sich-Einfügens in das Menschsein; in ihr verbinden sich Zumutung und Mut, hier entsteht das Bewusstsein des Begrenzten.
Vielleicht ist es genau das, was in der Kantate nachhallt – und uns berührt: die Bewegung des sich zur Erde neigenden Körpers, in der Wissen und Ungewissheit ineinander übergehen. In dieser Geste erscheint für mich auch Anna Magdalena Bach: eine Figur zwischen Leben und Sterben, deren Hände Bachs Musik bewahrten und deren Stimme sie vielleicht trug. Dass wir so wenig über sie wissen, ist kein Verlust, sondern Teil ihrer Präsenz – eine Leerstelle, die Raum lässt für unsere eigene Vorstellung. So wird Anna Magdalena zur stillen Zeugin von Sterben und Überleben, und die Kantate zum Echo eines Dazwischen – eines Moments, in dem das Leben sich der Erde zuneigt, suchend, fragend, tastend. Ich danke Ihnen.