Anselm Hartinger
Immer wieder erreichen uns Anfragen dazu, wie unsere Trompeter und Hornisten die sehr anspruchsvollen Bläserpartien der Bachschen Kantaten auf ihren nachgebauten Originalinstrumenten meistern können. Kenner der Szene vergleichen dabei auch gern die auf unseren Aufnahmevideos und Tonträgern dokumentierte Spielweise mit anderen Einspielungen und fragen nach Details der Bauform und Griffweise.
Generell ist und bliebt die Ausführung der Trompeten- und Hornpartien in Werken Bachs und anderer Meister des Spätbarock auf Originalklanginstrumenten eine schwierige Angelegenheit. Dies hat vor allem damit zu tun, dass diese Instrumente anders konstruiert waren und auch in abweichender Weise eingesetzt wurden als ihre Nachfolger im modernen Orchester. De facto auf den Vorrat der nur mit dem bläserischen Mundansatz gesteuerten „Naturtonreihe“ verwiesen, der in der Tiefe und in der Mittellage grosse Lücken aufweist und nur in der Höhe alle Halbtöne ausführbar macht, waren sie für das Spiel in der Mittellage – also selbst für die Begleitung einer einfachen Choralmelodie – de facto ungeeignet. Die typisch fanfarenhafte Melodik solcher Trompetenstimmen macht den Unterschied dieser Spiellagen sehr gut hörbar. Dieses Problem konnte zwar umgangen werden, indem man solche Partien dem zwar ebenfalls mit einem Mundstück geblasenen, jedoch mit Grifflöchern ähnlich einer Blockflöte ausgestatteten Zink (Cornetto/Cornettino) übertrug. Gerade bei Kantaten zu Kirchenfesten und Jubelfeiern war dies aus klanglichen Gründen und mit Blick auf die heroische Aura der glänzenden Blechinstrumente allerdings kaum möglich.
Die virtuosen und sehr hochliegenden Partien im sogenannten „Clarin“-Register sind dafür schon rein physisch herausfordernd schwer – nicht zufällig hat schon der Leipziger Stadtchronist Vogel 1734 das plötzliche Ableben von Bachs erstem Trompeter Gottfried Reiche auf die am Vorabend während der Aufführung von Bachs Kantate BWV 215 zu meisternden „strapazzen“ zurückgeführt, was verständlich macht, dass schon die Musiker der Bachzeit auf allerlei Weise versuchten, sich das Spiel zu vereinfachen. So gab es gerade im Leipziger Umfeld Bachs bauliche Innovationen und spieltechnische Hilfskonstruktionen wie etwa die von ebenjenem Gottfried Reiche benutzte „Zugtrompete“ (Tromba da tirarsi), die eine von der Posaune übernommenen Zugvorrichtung zur Ergänzung des Tonvorrats anfügte. Ähnliches gab es wahrscheinlich auch im Bereich der Hörner (sogenanntes Corno da tirarsi). Da die Musizierenden der barocken Ensembles anders als heute viele verschiedene Instrumente beherrschten, lagen solche Querverbindungen natürlich nahe – so wie Trompeter damals selbstverständlich zum Horn wechselten oder Oboisten auch Querflöte spielten. Nicht zuletzt darf man vermuten, dass sich die Musizierenden des 18. Jahrhunderts gelegentlich auch individuell die Ausführung etwas erleichterten, was bei Minusgraden und im morgendlichen Halbdunkel einer Kirche ohne Heizung und elektrisches Licht niemanden überraschen wird. Aus der Zeit um 1800 und noch bei den Bach-Einrichtungen Mendelssohns sind solche Vereinfachungen – also beispielsweise Tiefoktavierungen, zusätzliche Atempausen, vereinfachte hohe Koloraturen und gelegentlich sogar der Austausch von Trompeten zu Klarinetten – auch für die Leipziger Kirchenmusik schriftlich belegt; es ist daher sehr wahrscheinlich, dass diese späten Aufzeichnungen auf eine zuvor nur mündlich tradierte Praxis zurückgehen.
Diese Problematik wurde erst in einem bis nach 1850 andauernden Transformationsprozess gelöst, indem man einerseits durch aufsteckbare „Inventionsbögen“ leichter in andere Tonarten wechseln konnte und andererseits durch eingebaute Klappen und später Ventile den gesamten Tonvorrat spielbar machte. Ähnliches gilt für das schon im 18. Jahrhundert teilweise verwendete „Stopfen“ der Hörner mit der mehr oder weniger tief in den Schallbecher eingeschobenen Hand. Allerdings haben schon die Zeitgenossen Mendelssohns, Brahms‘ und Berlioz‘ die damit verbundenen Verluste an Farbigkeit und Klangschönheit bemerkt und beklagt.
Diese Flexibilität sollten wir heute unseren ausführenden Musikern ebenfalls zugestehen, da das Publikum insbesondere bei Tonträgern ein Mass an Perfektion erwartet, das ohne gewisse Kompromisse kaum zu erreichen ist. So mag es tatsächlich historisch nicht belegt sein, Trompeten mit zusätzlichen Griff-Löchern zu versehen – die in der Frühzeit der historischen Aufführungspraxis in den 1960er und 1970er Jahren noch weit verbreiteten gravierenden „Kiekser“ und Misstöne werden heute allerdings kaum noch hingenommen. Auch gibt es Hinweise darauf, dass auch bei frühen „Alte Musik“-Studioaufnahmen in solchen Fällen gewisse Tricks angewendet wurden, um ein für die Ohren erträgliches Resultat zu erzielen. Menschen, Musiker und Ensembleleiter von heute schätzen eben einen grundsätzlich farbigen Originalklang, erwarten aber eben doch eine ansprechende Ausführung jenseits der rein wissenschaftlichen Korrektheit.
Vielleicht wäre es das Beste, wenn sich Publikum und Ausführende dahingehend weiterhin verständnisvoll aufeinander zu bewegen. Hörende sollten wieder verstehen und akzeptieren, dass Trompeten und Hörner im Barock anders als im klassisch-romantischen Orchester eher selten benutzte klangliche „Kronen“ waren, deren kerniger Glanz mit gewissen Einbussen an der intonatorischen Perfektion verbunden war. Musizierende wiederum werden stets nach Wegen einer gut ins Ensemble integrierten Ausführung suchen, die die Besonderheit der historischen Instrumente und der mit ihnen verbundenen Klangidiome nicht verrät, aber doch gewisse Schärfen und Grenzen der Ausführbarkeit abmildert. So halten wir es seit langem in unseren Trogener Aufführungen, und so ist es übrigens auch in der Neuen Musik nicht ganz unüblich, wo manche „Werke“ nur deshalb sinnvoll aufgeführt werden können, weil sich verständige Musikerinnen und Musiker die zuweilen arg verkopften und praxisfernen Notationen einigermassen spielbar einrichten. Die Zeit des Barock jedenfalls hat die musikalische Intelligenz und den musikantischen Pragmatismus kundiger Ausführender immer vorausgesetzt und wertgeschätzt. Und selbst Bach, der meist gern ziemlich genau vorschreiben wollte, wie es nachher klingen sollte, hat im Zweifelsfall auf solche Impulse gehört und sich selbst natürlich alle Freiheiten der Umsetzung genommen.



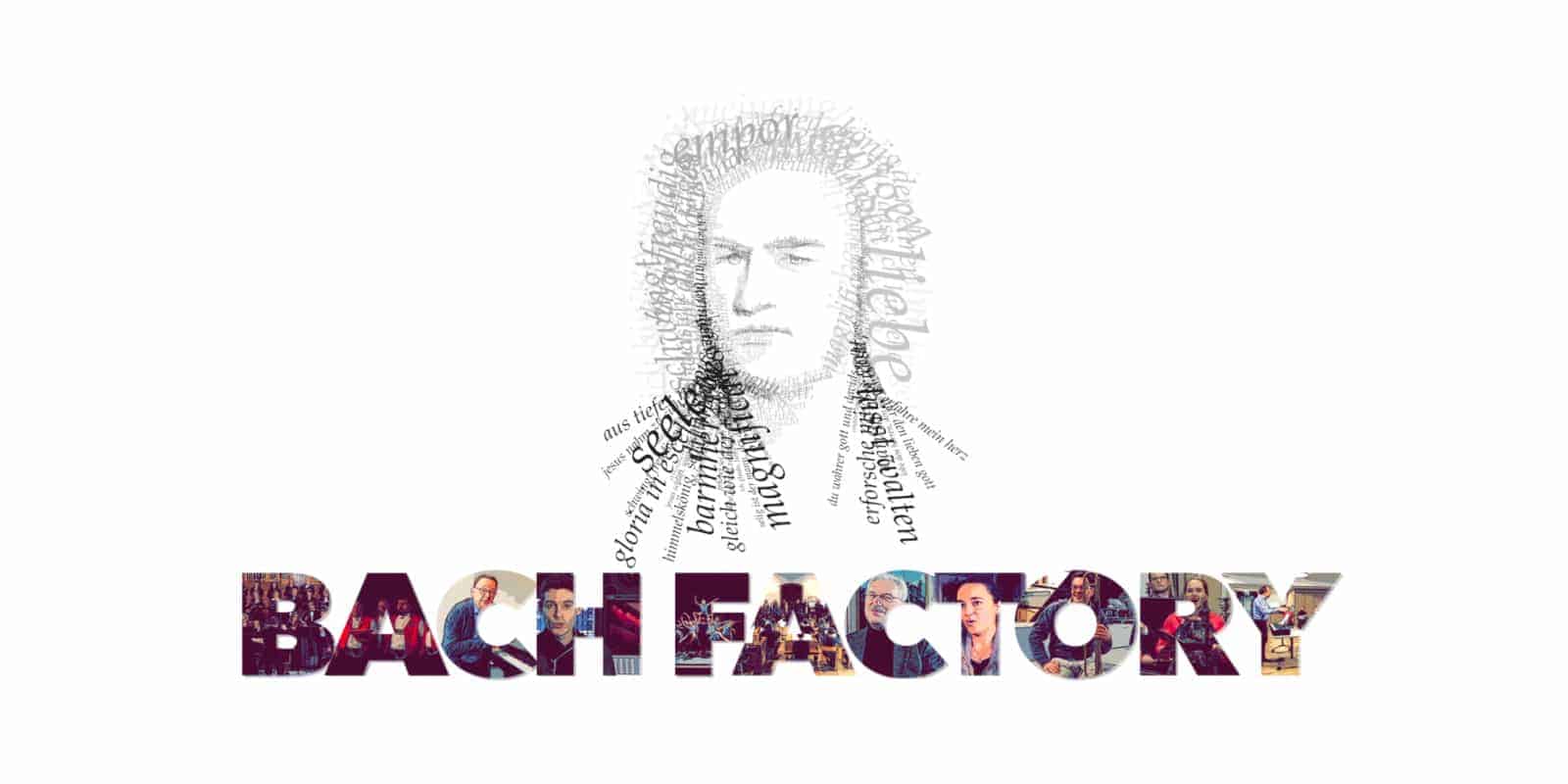
Hinterlassen Sie einen Kommentar
Wir freuen uns auf Ihr Feedback - Schreiben Sie uns einfach Ihre Meinung zu diesem Artikel.