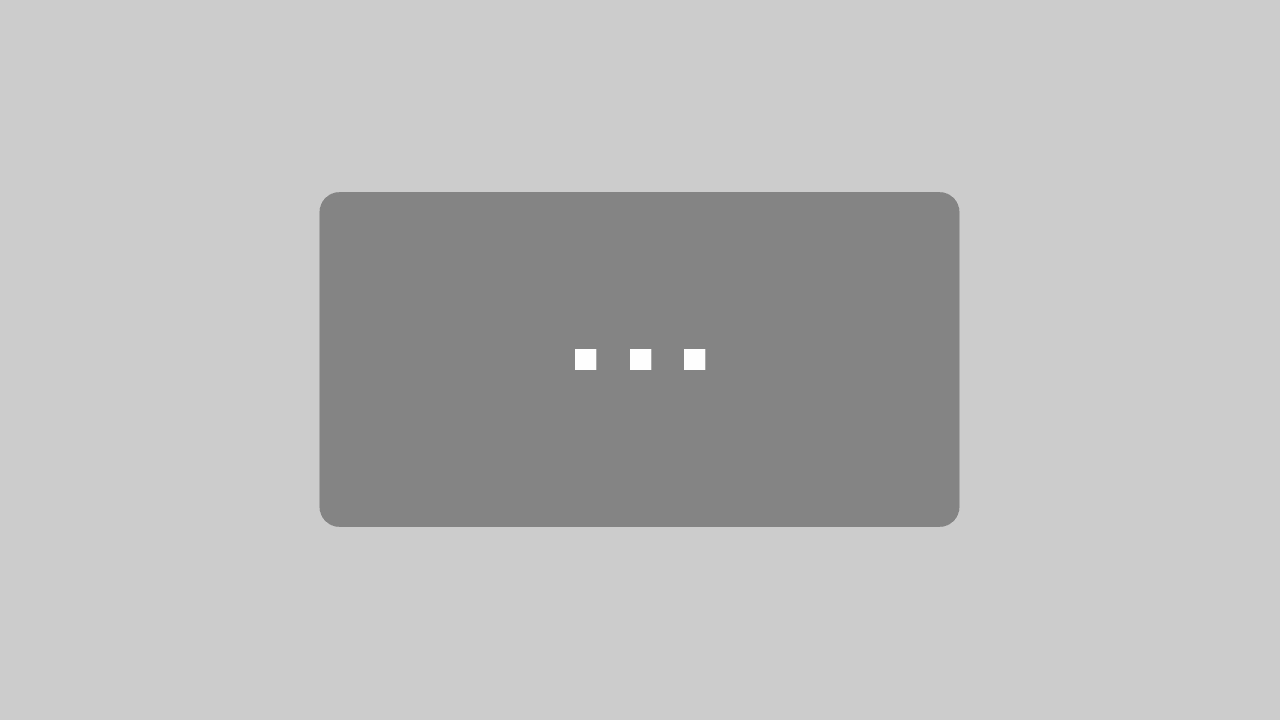Fürchte dich nicht
BWV 228 // Trauerfestakt
Für Vokalensemble (Doppelchor), Oboe I+II, Taille, Streicher und Basso continuo
Die für einen unbekannten Traueranlass entstandene achtstimmige Motette BWV 228 kombiniert Verse aus dem Buch Jesaja mit Choralstrophen aus Paul Gerhards Lied «Warum sollt ich mich denn grämen». Die Komposition besticht in ihrem ersten Teil durch ihr kraftvolles wechselchöriges Konzertieren, in dessen energischen Zuspruch «Fürchte dich nicht» sich immer wieder elegische Fortspinnungen mischen. Der auf vier Stimmen verdichtete zweite Hauptabschnitt führt in Bass, Tenor und Alt die beiden Textglieder «Denn ich habe dich erlöset» und «Ich habe dich bei deinem Namen gerufen» durch, über denen der Sopran zeilenweise das Gerhard‘sche Trostlied intoniert, bevor die Motette mit einer wirkungsvoll aufgefächerten Erinnerung endet: «Fürchte dich nicht.»
Motette von Johann Christoph Bach, «Fürchte dich nicht»
Fürchte dich nicht, denn ich hab‘ dich erlöst,
ich hab‘ dich bei deinem Namen gerufen,
du bist mein.
Wahrlich, ich sage dir:
Heute wirst du mit mir im Paradies sein.
O Jesu du, mein Hilf und Ruh,
ich bitte dich mit Tränen:
Hilf, dass ich mich bis ins Grab nach dir möge sehnen.
Johann Heinrich Schmelzer: «Lamento sopra la morte Ferdinandi III»
Motette von Johann Sebastian Bach, BWV 228 «Fürchte dich nicht»
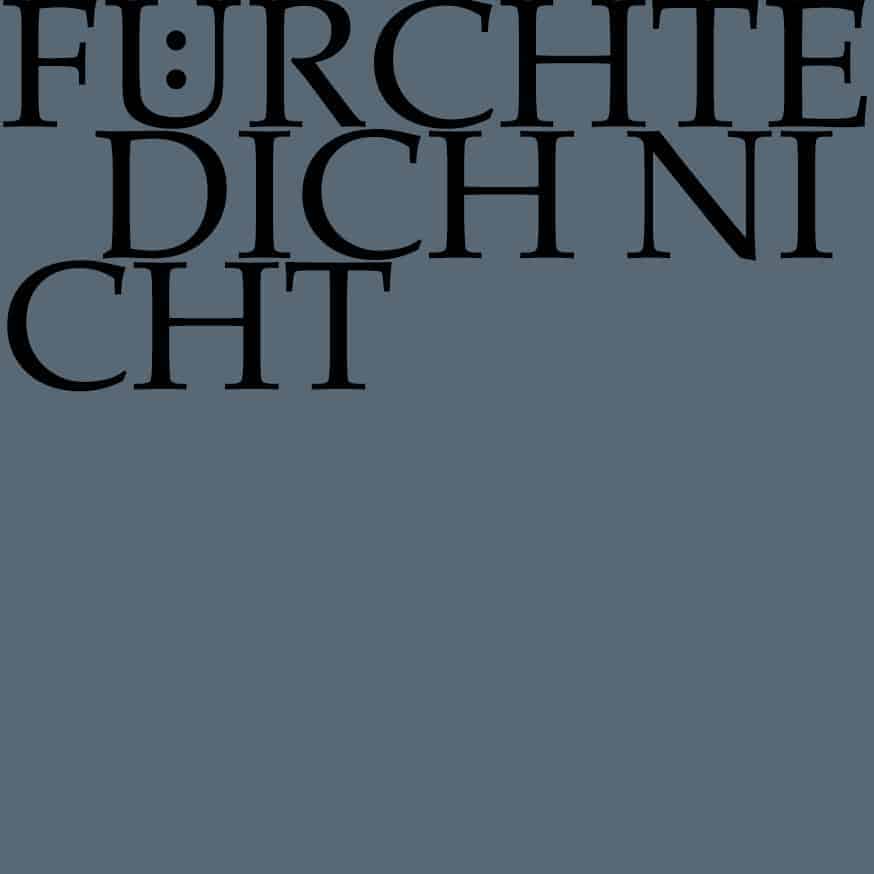
Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...
Werkeinführung
Reflexion
Bonusmaterial
Chor
Sopran
Lia Andres, Felicitas Erb, Simone Schwark, Noëmi Sohn Nad, Alexa Vogel, Mirjam Wernli
Alt
Laura Binggeli, Antonia Frey, Liliana Lafranchi, Damaris Rickhaus, Simon Savoy, Lea Pfister-Scherer
Tenor
Zacharie Fogal, Raphael Höhn, Tobias Mäthger, Sören Richter, Nicolas Savoy, Walter Siegel
Bass
Fabrice Hayoz, Grégoire May, Daniel Pérez, Retus Pfister, Jonathan Sells, Tobias Wicky
Orchester
Leitung
Rudolf Lutz
Violine
Eva Borhi, Peter Barczi
Viola
Matthias Jäggi
Violoncello
Maya Amrein
Violone
Markus Bernhard
Oboe
Katharina Arfken, Philipp Wagner
Taille
José Manuel Cuadrado Sánchez
Fagott
Susann Landert
Cembalo
Jörg-Andreas Bötticher
Orgel
Nicola Cumer
Musikal. Leitung & Dirigent
Rudolf Lutz
Werkeinführung
Mitwirkende
Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter
Reflexion
Referentin
Muhterem Aras
Aufnahme & Bearbeitung
Aufnahmedatum
22.11.2019
Aufnahmeort
Trogen AR (Schweiz) // Evangelische Kirche
Tonmeister
Stefan Ritzenthaler, Nikolaus Matthes
Regie
Meinrad Keel
Produktionsleitung
Johannes Widmer
Produktion
GALLUS MEDIA AG, Schweiz
Produzentin
J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz
Textdichter
Erstmalige Aufführung
Ungesichert; womöglich 4. Februar 1726,
Leipzig (zur Beerdigung von Susanna
Sophia Winckler)
Textdichter
Jesaja; Paul Gerhardt (1653)
Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk
Der Entstehungsanlass der Motette «Fürchte dich nicht» BWV 228 ist nicht gesichert. Im Unterschied zu den für den Leipziger Gottesdiensteingang und das Kurrende-Singen der Thomaner bestimmten Motetten und Hymnen des altehrwürdigen «Florilegium portense» (1603–1621) waren Bachs neue Motetten Gelegenheitswerke, die wohl überwiegend mit Trauerfeiern zu tun hatten – ohne dass sich dies mit Ausnahme von «Der Geist hilft unser Schwachheit auf» BWV 226 (1729; zum Begräbnis des Schulrektors Ernesti) bisher konkretisieren liess. Eine Beziehung zum Begräbnis der Leipziger Patrizierin Susanna Sophia Winckler (1726) wurde aufgrund der Gemeinsamkeit von Motettentext und Leichenpredigt (Jesaja 43, 1) lange angenommen, bleibt neueren Recherchen Daniel Melameds und Klaus Hofmanns zufolge aber fraglich. In ihrer auf achtstimmigen Doppelchor und simultane Behandlung von Spruchtext und Kirchenlied gestützten Faktur steht die Motette in der für Bach prägenden Thüringer Tradition. Dass der Singchor durch Streicher und Holzbläser verstärkt wurde, lässt sich aufgrund der auf Partiturabschriften begrenzten Überlieferung nicht beweisen; doch öffnet diese für BWV 226 und weitere Parallelstücke belegte Praxis eine Tür für die von Rudolf Lutz eingerichtete Fassung, die sich überdies auf Spuren einer Generalbassbegleitung im Chorbass stützen kann. Die dem Cembalo übertragene Intonation haucht dabei der alten Idee Arnold Scherings, die in den Leipziger Kirchen vorhandenen und in den Kantatenaufführungen nur ausnahmsweise geforderten Cembali seien für die Motettenbegleitung bestimmt gewesen, unerwartetes Leben ein…
Die Motette beginnt mit einem von beiden Bässen angestossenen Dialog, der die Zusage «Fürchte dich nicht» mit einer motivischen Energie versieht, die das gesamte Stück über anhält und zweimal rahmend wiederkehrt. Dieser gestische Zuspruch ist auch dem Eingangsmotiv selbst eingeschrieben, dessen engschrittiger Nachsatz «Ich bin bei dir» wie eine Antwort auf die vom Tonsprung «nicht» ausgelöste Frage wirkt.
Nach dichten Chorwechseln über «Weiche nicht, denn ich bin dein Gott» triumphal einsetzend und daher noch heute bei den grossen Thomanern äusserst beliebt ist die durch die Stimmen geführte Koloratur «Ich stärke dich». Sie geht in ein verhaltenes Konzertieren über, das den prophetischen Text wie einen Vorhang erst nach und nach enthüllt und dabei in steter kontrapunktischer Verdichtung zusehends ausschmückt («Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich»). Auf eine neuerliche Akklamation «Fürchte dich nicht» folgt der Umschlag in den zweiten Werkteil, der beide Chöre zu einer vierstimmigen Einheit verschmilzt. Mit dieser Konzentration korrespondiert eine Ausweitung der satztechnischen Kunst, da Bach eine ausgedehnte Doppelfuge der drei Unterstimmen («Denn ich habe dich erlöset, ich habe dich bei deinem Namen gerufen») mit dem zeilenweisen Vortrag der Choralstrophen «Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden» und «Du bist mein, weil ich dich fasse» im Sopran kombiniert. Diese Verbindung von meditativer Ruhe und polyphoner Beweglichkeit kulminiert in einer achtstimmigen Schlussgruppe, die trotz ihrer Kürze die Kernbotschaft mit maximaler Trostkraft bekräftigt: «Fürchte dich nicht, du bist mein!»
Ob Bach das Werk an dieser Stelle mit einem transponierten «B-A-C-H» im ersten Bass persönlich signiert hat, sei dahingestellt – welches Geschenk er mit dieser Motette jedoch allen künftigen Sängern und Hörern machte, wird noch durch eine Leipziger Rezension von 1837 belegt. Diese beschreibt zunächst das aufgrund der grotesk fehlerhaften Komposition eines jungen Nachwuchstonsetzers drohende Scheitern der musikalischen Vesper in der Thomaskirche, ehe sie Bachs Motette als wahre Qualitätsmarke hervorhebt: «… die Zuhörer verbissen oft Lachen, oft runzelten sie die Stirn, oft litten sie an Ohrenzwang, so dass sie sich gewiss bald entfernt hätten, wenn ihnen nicht Vater Bach in den Weg getreten wäre, mit seinem weltberühmten Troste: ‹Fürchte dich nicht, ich bin bei dir! Denn ich habe dich erlöset.›»
Dem Umkreis der von Johann Sebastian Bach gesammelten Kompositionen seiner Vorfahren gehört die fünfstimmige Motette «Fürchte dich nicht» seines Eisenacher Onkels Johann Christoph Bach (1642–1703) an – ein Meister, den Bach als «grossen ausdrückenden Componisten» wertschätzte. Auch sie kombiniert einen Spruchchor mit einem im Diskant angesiedelten Choralvortrag. Diese fünfte Strophe aus Johann Rists Passionslied «O Traurigkeit, o Herzeleid» deutet ebenso wie der verheissende Textschluss «Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein» (Luk 23, 43) auf eine von Bildern des Kreuzesopfers getragene Trauermusik. Das für vierstimmiges Streicherconsort bestimmte Lamento des Wiener Geigers und Vizekapellmeisters Johann Heinrich Schmelzer (ca. 1623–1680) entstand hingegen als Gedenkstück für den 1657 verstorbenen Kaiser und bedeutenden Musiker Ferdinand III. Im traurig-gespannten h-Moll gehalten, ist es mit schmerzlichen Intervallen und redenden Klagetopoi («Trauerläuten») durchsetzt und bildet dabei einen noblen persönlichen Tonfall aus. Beide Stücke werden auf dieser CD als Bonustracks mit eingespielt.
Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen
1. Chor
Fürchte dich nicht, ich bin bei dir,
weiche nicht, denn ich bin dein Gott!
Ich stärke dich, ich helfe dir auch,
ich erhalte dich durch die rechte Hand
meiner Gerechtigkeit.
1. Chor
Bachs Motette beginnt mit einem Zitat aus dem
Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 41, Vers 10. Ursprünglich
als trostvolle Gottesrede an das Volk Israel
in politisch schwierigster Lage gestaltet (nach
der Eroberung Jerusalems durch den Perserkönig
Kyros), werden diese Worte hier zur persönlichen
Anrede an Trauernde: «Fürchte dich nicht, ich bin
bei dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott!» Im
Fortgang ist die Zusicherung Gottes formuliert,
dass er stärke, helfe und erhalte. Bach arbeitet hier
mit blockhaften Anreden, die im wechselchörigen
Vortrag besondere Eindringlichkeit erhalten. Das
kraftvolle «Ich stärke dich» gehört dabei noch heute
zu den bei den Thomanern beliebtesten Bachpassagen.
Typisch für dessen Motettenstil ist die zunehmende
Verschmelzung der Teilchöre zu einer dichten
und dennoch kantablen Polyphonie.
2. Chor
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich
erlöset, ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, du bist mein.
Fürchte dich nicht, du bist mein!
2. Chor
Die Schlusszeile des ersten Teils bringt schon den ersten
Vers von Jesaja 43, 1b (sie ist allerdings identisch mit
der ersten Zeile von Jesaja 41, 10), während der zweite
Teil der Motette mit dem Fortgang des Jesaja-Zitates
einsetzt: «Denn ich habe dich erlöset, ich habe dich bei
deinem Namen gerufen, du bist mein.» Auch dies ursprünglich
eine Trostrede, die dem Volk Israel Beistand
zusichert trotz Niederlage und Deportation, wird dieser
Trost im Kontext der Motette individualisiert und personalisiert:
Die Trauernden sollen gewiss sein, dass mit
der Erlösung die Verstorbene nicht verloren ist: «Du bist
mein.» Obwohl auch der erste Abschnitt kontrapunktische
Einsatzfolgen ausbildete, verleiht erst die mit einer
Verdichtung auf vier Stimmen einhergehende Doppelimitation
dem Gesamtsatz an ein Präludium mit nachfolgender
Fuge erinnernde Züge. Mit der Verbindung
einer aufsteigenden Themengestalt («Ich habe dich bei
deinem Namen gerufen») mit einem in schmerzvollen
Halbtönen absteigenden Soggetto («Denn ich habe
dich erlöset») öffnet Bach einen weiten Raum musiktheologischer
Deutungen vom Kreuzestod bis zur Erlösungshoffnung.
3. Choral
Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden,
du bist mein,
ich bin dein,
niemand kann uns scheiden.
Ich bin dein, weil du dein Leben
und dein Blut mir zugut
in den Tod gegeben.
3. Choral
Es war bereits für den Bachschüler Johann Philipp
Kirnberger nicht einfach, herauszufinden, um welchen
Choral es sich handelte. Denn in der verlorenen
Originalpartitur wird Bach wie auch sonst die Choraltexte
als bekannt vorausgesetzt haben, so dass er nur
knappe Hinweise für die Kopisten notierte. So suchte
Kirnberger und notierte mit einem Stossseufzer, endlich
habe er den Choral gefunden: Es waren die beiden
Schlussstrophen des Liedes «Warum soll ich mich
denn grämen» von Paul Gerhardt (1653) mit der Melodie
des Berliner Nikolai-Organisten Johann Georg
Ebeling (1666/67), das als Lied RG 678 in unserem Gesangbuch
steht. Wieder zeigt sich, wie Bach das Gesamtkorpus
der Choräle in- und auswendig kannte:
Denn hier verbindet sich die göttliche Zusage «Du bist
mein» des Jesaja-Textes mit der Antwort des Geschöpfs
im Choral, das in Gott den Hirten, den
«Brunn aller Freuden» sieht: «Du bist mein, ich bin
dein, niemand kann uns scheiden.»
4. Choral
Du bist mein, weil ich dich fasse
und dich nicht, o mein Licht,
aus dem Herzen lasse.
Laß mich, laß mich hingelangen,
da du mich und ich dich
lieblich werd umfangen.
4. Choral
Die zweite Strophe des Gerhardt-Liedes führt das «Du
bist mein» der vorigen Strophe fort und vertieft es:
«Weil ich dich fasse … und dich nicht aus dem Herzen
lasse.» Es schliesst mit der wiederholten Bitte des Geschöpfs
an Gott, er möge es «hingelangen» lassen –
womit die endzeitliche mystische Unio im Bild des
gegenseitigen Umfangens ausgedrückt ist. Durch den
nach Art einer Orgelbearbeitung immer wieder herausgezögerten
Einsatz und die ruhige Melodieführung
erhält der Choral gegenüber dem dichten Kontrapunkt
der Unterstimmen eine besondere Leuchtkraft,
ehe Bach mit der verkürzten Wiederkehr des doppelchörigen
«Fürchte dich nicht» seine Motette mit glaubensstarker
Gewissheit enden lässt.
Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Musikerinnen und Musiker, Technikerinnen und Techniker und organisatorisch Beteiligte, liebe Bach-Community,
ich höre diese Motette, die Motette «Fürchte dich nicht», nicht zum ersten Mal.
Das ist nicht weiter erstaunlich. Immerhin musste ich meine Reflexion für heute Abend vorbereiten. Trotzdem kommt es mir gerade fast so vor, als hörte ich das «Fürchte dich nicht» heute wieder zum ersten Mal. Wahrscheinlich, weil mich die Musik einfach berührt. Weil sie etwas in mir auslöst. Und für mich zeigt das auch die Universalität, die Zeitlosigkeit, ja die Kraft, die in dieser Motette steckt.
Sich immer wieder aufs Neue berühren lassen. Diesen Funken des «Wie zum ersten Mal» wahrnehmen. Ich glaube, es lohnt sich, diesen Funken des «Wie zum ersten Mal» entstehen zu lassen, ihn zu suchen – in der Musik, in Menschen, in Gemeinschaften.
Ich habe mich deshalb entschieden, Ihnen, liebes Publikum, heute keine abstrakt geschliffene Reflexion zu liefern. Stattdessen will ich Sie mitnehmen: zum «ersten Mal» Motette «Fürchte dich nicht» für mich. Und ich will Sie mitnehmen auf die Gedankenwege, die sich daran anschlossen.
Zunächst schicke ich vorneweg: Ich höre sehr gerne klassische Musik. Ich gehe regelmässig in die Oper in Stuttgart. Auch Reflexionen über verschiedenste Themen kommen in meinem Alltag als Politikerin, insbesondere auch als Landtagspräsidentin, sehr regelmässig vor. Politik betrifft immer das gesamte Zusammenleben in einer Gesellschaft. Da sind die Themen natürlich vielfältig. Beides zusammen aber, Reflexion eines klassischen Musikstücks – das ist für mich eine Premiere. Damit auch in der Hinsicht ein «erstes Mal».
Ich habe mich also vor ein paar Wochen, abends nach einer Plenarsitzung, in mein Büro gesetzt und YouTube aufgerufen. Ich gebe zu: Ich war an diesem Tag schon etwas müde. Die Debatten im Parlament waren intensiv, teilweise hitzig, auch die ein oder andere verbale Grenzüberschreitung hatte leider stattgefunden. Auf dem Schreibtisch meiner Sekretärin lag ein geschmackloser Hassbrief für mich. (Ich erspare Ihnen die Formulierungen.)
Kurz zusammengefasst: Ich war froh, mich in mein Büro zurückzuziehen und einige Minuten für mich zu sein. Ich rief also YouTube auf, tippte ein: «Bach Motette BWV 228». Die Unterlagen hatte ich schon in der Hand, die ich währenddessen durchsehen wollte. Aber dazu kam ich erst gar nicht.
Die Musik, also die Stimmen, fesselten mich vom ersten Moment an.
Fürchte dich nicht.
Weiche nicht.
Was für eine Energie!
Was für eine Kraft!
Allein in diesen beiden Satzfragmenten!
Ich hörte weiter zu und schrieb im Anschluss auf, was mir als Erstes in den Sinn kam.
Das waren die vier Adjektive: drängend, fordernd, mitreissend, überzeugend.
Ich war wieder hellwach. Ich nahm den Liedtext in die Hand und spielte das Stück nochmals von vorne. Wieder diese Energie.
Beim zweiten Mal hörte ich nicht nur mit dem Herzen. Mein Kopf schaltete sich dazu.
Fürchte dich nicht!
Weiche nicht!
Das klang für mich wie ein Auftrag.
Ich dachte an die liberale Demokratie und an die Bedrohungen, der sie ausgesetzt ist. In Deutschland. In Europa. Bedrohungen wie wachsender Antisemitismus. Rechtsextremistische Gewalt. Politische Morde. Denken wir nur an den jüngst glücklicherweise gescheiterten Anschlag auf eine Synagoge im Osten Deutschlands. Bei dem leider trotzdem zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Oder den rechtsextrem motivierten Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübke im Südwesten Deutschlands diesen Sommer.
Und da gibt es auch die etwas subtileren Bedrohungen der Demokratie wie Hass und Hetze auf den Strassen und in den digitalen Netzwerken. Und das aus meiner Sicht Besorgniserregendste: die Konsensverschiebung. Oder anders formuliert: Das Sagbare, das Denkbare rückt nach rechts, hin zum Menschenfeindlichen, weg vom Prinzip der unantastbaren Menschenwürde. Rassismus und Diskriminierung sickern in die Sprachspiele der öffentlichen Meinung.
Fürchte dich nicht!
Weiche nicht!
Ich hörte einen Auftrag an Demokratinnen und Demokraten.
Ich hörte einen Auftrag ganz persönlich an mich selbst.
Musikalisch finde ich es sehr interessant, dass Bach diesen Auftrag meiner Meinung nach auch mit den beiden Chören abgebildet hat: Die höheren Sopran-, Alt- und Tenorstimmen wirken wie die Furcht selbst – ängstlich, erschrocken, furchtsam. Die tieferen Bassstimmen dagegen bilden ein Fundament, strahlen in ihrer Stabilität Zuversicht aus, Vertrauen, Gelassenheit.
Beide Ebenen zusammen erzeugen für mich gleich zu Beginn der Motette diesen drängenden, fordernden Auftrag. Um dann – was für eine Erleichterung! – in diese wunderbaren Zeilen «Ich stärke dich», «Ich helfe dir auch» zu wechseln. Nach dem Auftrag kommt das Angebot:
Ich stärke dich.
Ich helfe dir auch.
Ähnlich wie in der griechischen Mythologie. Sie kennen vielleicht die archetypische Heldenreise, die das Grundmuster vieler Mythen und auch vieler Geschichten heute bildet. Der Held – und heute zum Glück auch die Heldin – erhält darin zuerst den Ruf des Abenteuers. Wer dem Ruf folgt, bekommt Unterstützung durch Mentoren, Götter oder Magie. Nach dem Auftrag kommt das Angebot.
Musikalisch fiel mir dabei auf, dass aus dem 8-stimmigen Chor zunächst eine einzige Stimme vorangeht. Ein erstes, einzelnes «Ich stärke dich», bevor die anderen Stimmen mit einfallen. Vielleicht ist mit dieser ersten, klaren Stimme die eigene innere Stimme gemeint, die es angesichts der Furcht zu hören gilt. Die eigene innere Stimme. Vielleicht auch die Stimme Gottes. Oder die Stimme eines guten Freundes, einer guten Freundin, die sagt: «Hey, du schaffst das!» – «Ich unterstütze dich!» – «Mach weiter!»
Als ob wir, angesichts einer Bedrohung, erst die eigene Souveränität erlangen müssten, um dann vom Chor der Stimmen um uns herum Unterstützung und Hilfe zu erfahren.
Ich denke da an die unzähligen Menschen, die sich gerade in diesen Zeiten für unsere liberale Demokratie, für eine offene Gesellschaft, für ein Zusammenleben in Toleranz und Vielfalt engagieren. Die am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Verein oder im Gemeindezentrum Stellung beziehen: gegen Ausgrenzung, gegen Rassismus, gegen Diskriminierung.
Vom drängenden, fordernden Auftrag: Verteidige unsere freiheitliche Demokratie!
Weiche nicht!
Hin zum mitreissenden, überzeugenden Angebot: Wir machen mit! Wir unterstützen dich!
Ich stärke dich!
Besonders gut gefällt mir an dieser Motette auch: Die musikalische Struktur ist sehr komplex. Trotzdem ergänzen sich die einzelnen Stimmen. Es würde definitiv etwas fehlen, wenn es eine Stimme weniger wäre. Gleichzeitig ist keine Stimme zu dominant. Keine Stimme übertönt die anderen Stimmen. Darin steckt für mich das Ideal unserer parlamentarischen Demokratie: Jede Stimme kommt zu Gehör. Und unsere Aufgabe ist es, einen Konsens zu finden.
Auf diese Weise komponieren wir eine Politik, die das Wollen einer Gesellschaft ausdrückt und die die gesellschaftlichen Stimmen bündelt: zu einem freien und für alle fairen Zusammenleben.
Bach hören ist also eine wunderbare Erinnerung für uns, an das Ideal der Demokratie, an das Zusammenspiel in einer Gesellschaft, an das Musikalische in einer Gemeinschaft.
Gleichzeitig rückt der Text der Mottete «Fürchte dich nicht» den Einzelnen, die Einzelne in den Mittelpunkt. Und schafft damit den Ausdruck der Dialektik zwischen Individuum und Gesellschaft. Die Zeile «Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein» macht das ganz deutlich.
Beim eigenen Namen gerufen zu werden, ist etwas sehr Persönliches. Ich, Mensch, werde erkannt, werde benannt, werde gerufen, darf sein mit meiner ganz eigenen, einzigartigen Identität. Ich, Mensch, bin die relevante Bezugsgrösse auch in der Demokratie.
Der Staat schützt meine Grundrechte. Er gewährt mir Freiheitsrechte wie Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit. Er garantiert mir Gleichheitsrechte wie die Gleichbehandlung vor dem Gesetz. Er räumt mir Leistungsrechte ein wie zum Beispiel das Petitionsrecht.
Und in einer Demokratie stehen uns diese Grundrechte zu, ganz einfach deshalb, weil wir Menschen sind. Wir sollen selbst entscheiden, wie wir leben und was wir denken. Wir sind keine «einheitliche Masse», wir sind kein «Volkskörper», wir sind kein «entmenschlichtes System», wie das rechtspopulistische Auffassungen suggerieren.
Wir sind einzigartig, sehr verschieden und vielfältig. Und im Schutz der Grundrechte spiegelt sich beides: der Einzelne, die Einzelne mit seiner / ihrer unantastbaren Würde. Und das menschliche Miteinander in den Grundregeln, an die wir uns halten.
An diesem Punkt treffen sich übrigens auch Politik und Religion: Das Motiv ist der Mensch. Dieses Motiv muss immer mitschwingen. Auf dieses Motiv müssen wir hören, auch wenn Parolen laut werden, wenn Feindbilder ängstigen, wenn das «Wir gegen die» in uns und um uns herum anschwillt.
«Ich habe dich bei deinem Namen gerufen.»
Das Motiv ist auch bei Bach der einzelne Mensch.
Sehr geehrte Damen und Herren,
dieser Abend, an dem ich das «Fürchte dich nicht» zum ersten Mal gehört habe, wird mir sicher in Erinnerung bleiben. Die Musik hat mir Mut gemacht, hat mich zuversichtlich gestimmt.
Wir, Sie und ich, werden die Motette jetzt gleich zum zweiten Mal hören. Und ich will Ihnen einen Vorschlag dazu machen:
Lassen Sie uns nach dem Funken des «Wie zum ersten Mal» Ausschau halten. Jetzt beim Hören der Motette. Und ganz grundsätzlich als Einzelne unseres gesellschaftlichen Miteinanders, als Bürgerinnen und Bürger unserer liberalen Demokratie.
Lassen Sie uns die Gewissheiten, die Selbstverständlichkeiten, das Festgefahrene aufbrechen.
Und lassen Sie uns mit neuen Augen – wie zum ersten Mal – auf die Demokratie schauen
– auf unsere Rechte und auf unsere Freiheit.