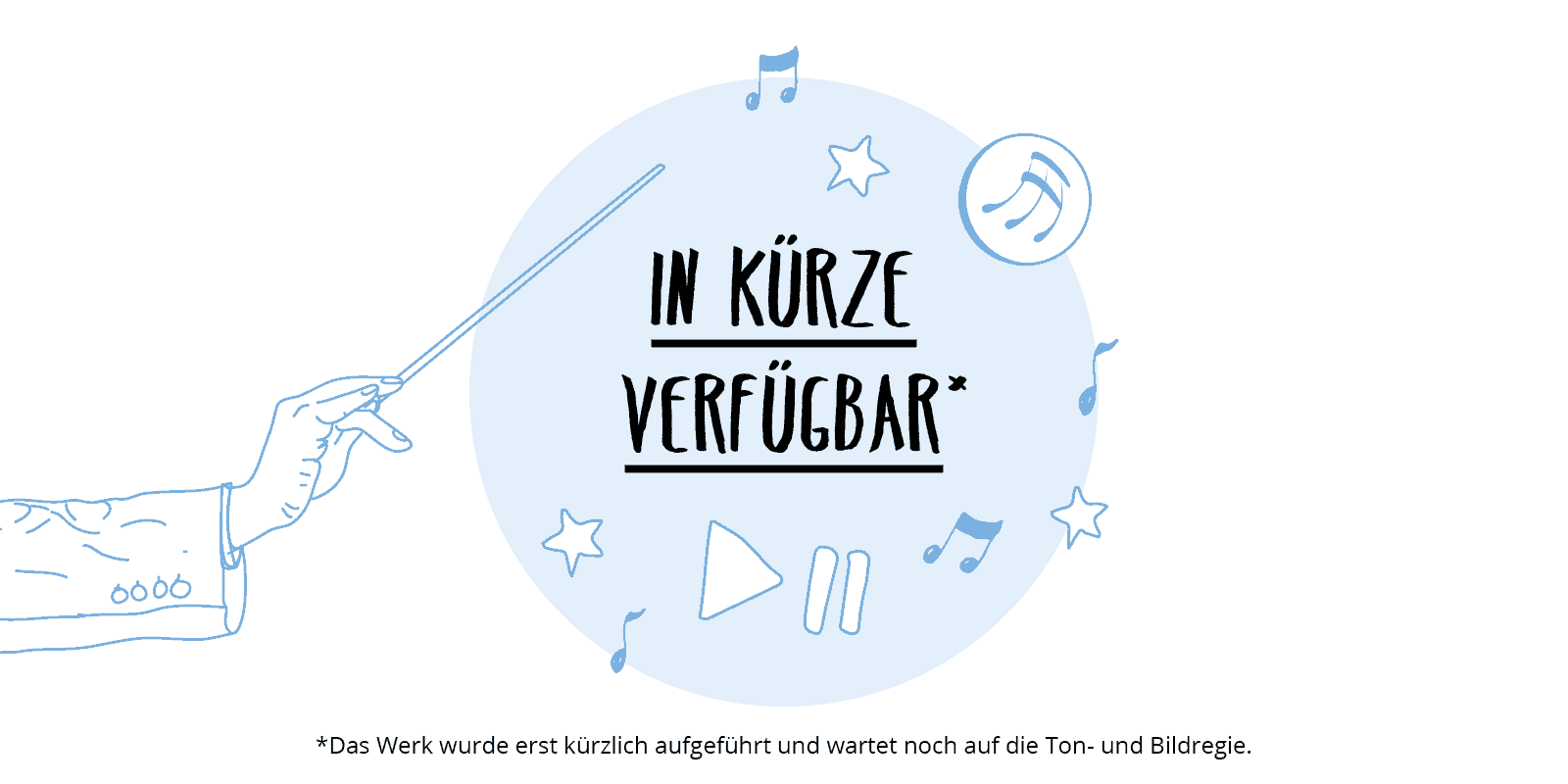Liebster Immanuel, Herzog der Frommen
BWV 123 // Epiphanias/Dreikönigsfest
für Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Traversflöte I+II, Oboe d’amore I+II, Streicher und Basso continuo
Es ist nicht der am Himmel funkelnde Morgenstern selbst, der diese Epiphaniasmusik durchleuchtet. Vielmehr bietet Bach die lichte Klanglichkeit von Traversflöten und Oboen d’amore sowie einprägsame Rhythmen und prägnant artikulierte Melodiezüge auf, um den Widerschein der mit dem Jesuskind in die Welt gekommenen neuen Realität im Menschenherz zu beschreiben. Das Spektrum der Affekte reicht dabei von der kindlichen Geborgenheit des Eingangschores über die einsichtsvolle Bereitschaft zur «harten Kreuzesreise» bis zur entschlossenen Hinwendung zum Mensch gewordenen Jesus in aller « Einsamkeit» der Welt. Diese so gar nicht kämpferisch-choralmässige Immanuelskantate markiert einen nachdenklichen Jahresbeginn, den in aller Hoffnung ein Hauch wissender Trauer durchzieht.
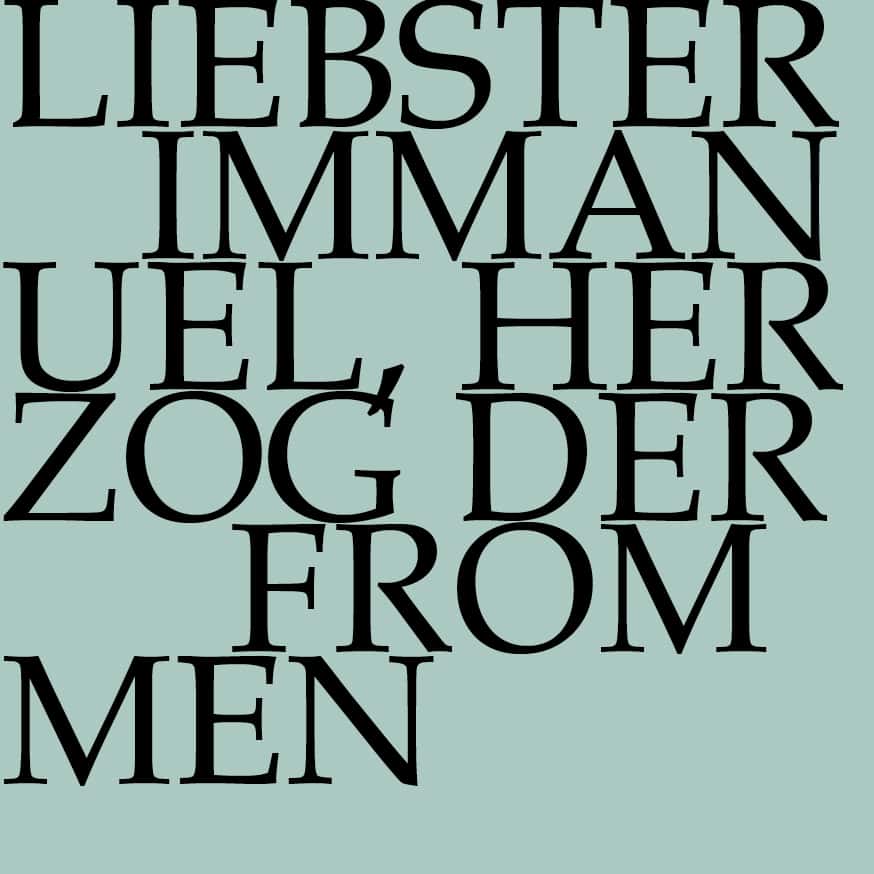
Chor
Sopran
Lia Andres, Linda Loosli, Simone Schwark, Susanne Seitter, Noëmi Tran-Rediger, Baiba Urka
Alt
Anne Bierwirth, Antonia Frey, Laura Kull, Lea Scherer, Jan Thomer
Tenor
Manuel Gerber, Tobias Mäthger, Christian Rathgeber, Walter Siegel
Bass
Jean-Christophe Groffe, Christian Kotsis, Daniel Pérez, Philippe Rayot, William Wood
Orchester
Leitung
Rudolf Lutz
Violine
Renate Steinmann, Salome Zimmermann, Elisabeth Kohler, Monika Baer, Lisa Herzog-Kuhnert, Patricia Do
Viola
Susanna Hefti, Claire Foltzer, Matthias Jäggi
Violoncello
Jakob Valentin Herzog, Hristo Kouzmanov
Violone
Markus Bernhard
Traversflöte
Tomoko Mukoyama, Rebekka Brunner
Oboe d’amore
Katharina Arfken, Clara Espinosa Encinas
Fagott
Gilat Rotkop
Cembalo
Thomas Leininger
Orgel
Nicola Cumer
Musikal. Leitung & Dirigent
Rudolf Lutz
Werkeinführung
Mitwirkende
Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter
Reflexion
Referentin
Nina Kunz
Aufnahme & Bearbeitung
Aufnahmedatum
12.01.2024
Aufnahmeort
Trogen (AR) // Evang. Kirche
Tonmeister
Stefan Ritzenthaler
Regie
Meinrad Keel
Produktionsleitung
Johannes Widmer
Produktion
GALLUS MEDIA AG, Schweiz
Produzentin
J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz
Textdichter
Erste Aufführung
6. Januar 1725, Leipzig
Textgrundlage
Ahasverus Fritsch (Sätze 1, 6); Unbekannt (Sätze 2–5)
Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen
1. Chor
Liebster Immanuel, Herzog der Frommen,
du, meiner Seelen Heil, komm, komm nur bald!
Du hast mir, höchster Schatz, mein Herz genommen,
so ganz vor Liebe brennt und nach dir wallt.
Nichts kann auf Erden
mir liebers werden,
als wenn ich meinen Jesum stets behalt.
1. Chor
Der Choral von Ahasverus Fritsch aus dem Jahr 1679, dessen erste und letzte Strophe dieser Kantate ihren festen Rahmen geben, beginnt mit den Worten «Liebster Immanuel» (hebräisch Im-anu-el = wörtlich: Mit-uns-Gott). Und auch wenn dieser dann als «Herzog der Frommen » (althd. «herizogo» = Heerführer) bezeichnet wird, so lässt die mystische Liebessprache keinen Zweifel, dass der in dieser Musik zum letzten Weihnachtssonntag Epiphanias als «meiner Seelen Heil» und «höchster Schatz» Besungene niemand anders als Jesus sein kann. Der sehnsüchtige Tonfall und die mehr arienmässige als choralhafte Sprache und Melodik der Liedstrophe haben Bach zu einer elegischen h-Moll-Vertonung im schwebenden 9∕8-Takt angeregt, die sich vom Normtypus des Choraljahrgangs ein ganzes Stück entfernt. So treten an die Stelle konzertanter Vorimitationen zarttönende Zusammenklänge, die wie die omnipräsente Tonwiederholung «Liebster Immanuel» den auf Dialog und sensible Ansprache setzenden Satzcharakter prägen. Bach gelingt es dabei vom ersten Takt an, eine in sich ruhende Bewegung zu organisieren, die liebende Fürsorge und staunende Anbetung zugleich verkörpert.
2. Rezitativ — Alt
Die Himmelssüßigkeit, der Auserwählten Lust,
erfüllt auf Erden schon mein Herz und Brust,
wenn ich den Jesusnamen nenne
und sein verborgnes Manna kenne:
Gleichwie der Tau ein dürres Land erquickt,
so ist mein Herz
auch bei Gefahr und Schmerz
in Freudigkeit durch Jesu Kraft entzückt.
2. Rezitativ — Alt
Der unbekannte Textdichter nimmt im Rezitativ die sinnlich-barocke Metaphorik des Fritsch- Chorals auf, spricht von der «Himmelssüßigkeit » und dem mit Jesu Namen verbundenen «Manna», das in einer dürren Seelenlandschaft wie Tau wirken und erquicken werde.
3. Arie — Tenor
Auch die harte Kreuzesreise
und der Tränen bittre Speise
schreckt mich nicht.
Wenn die Ungewitter toben,
sendet Jesus mir von oben
Heil und Licht.
3. Arie — Tenor
Die Tenorarie verschweigt das Leiden, die «harte Kreuzesreise» und «der Tränen bittre Speise» nicht, bringt aber die Gewissheit zum Ausdruck, dass auch bei tobenden persönlichen Ungewittern Jesus «von oben» Heil und Licht senden werde. Im affektgeladenen fis-Moll und schwer atmenden «Lente»-Duktus angesiedelt, leitet Bach bereits im meisterlich eingefädelten Triosatz des Oboenvorspiels seine Melodiezüge über sprechende Kreuzerhöhungen und schmerzhafte Intervalle hinweg, denen sich der nobel aussingende Tenor ebenso anschliesst, wie er sich im dramatisch aufgeladenen Mittelteil virtuos zu behaupten weiss.
4. Rezitativ — Bass
Kein Höllenfeind kann mich verschlingen,
das schreiende Gewissen schweigt.
Was sollte mich der Feinde Zahl umringen?
Der Tod hat selbsten keine Macht,
mir aber ist der Sieg schon zugedacht,
weil sich mein Helfer mir, mein Jesus, zeigt.
4. Rezitativ — Bass
Das Rezitativ der Bassstimme verstärkt das Gesagte: «Kein Höllenfeind», keiner «Feinde Zahl» und der Tod habe «selbsten» keine Macht, weil dem Frommen der «Sieg schon zugedacht» und Jesus sich als Helfer zeige.
5. Arie — Bass
Laß, o Welt, mich aus Verachtung
in betrübter Einsamkeit!
Jesus, der ins Fleisch gekommen
und mein Opfer angenommen,
bleibet bei mir allezeit.
5. Arie — Bass
Die Bassarie reflektiert trotz «betrübter Einsamkeit » und betonter Weltverachtung, dass der in der Welt erschienene (epiphanein) Jesus sein Opfer angenommen habe und so «allezeit» bei ihm bleiben werde. Für diese eigenwillige Verknüpfung von Weltabwendung und Heilandszuversicht hat Bach mit einem Triosatz aus Traversflöte, Bass und Continuo eine kontrastreiche Umsetzung gefunden, deren durchsichtiger Beweglichkeit man den sonst triumphierenden Charakter der Tonart D-Dur so gar nicht anhört. Die ausdrucksstarken Liegetöne und Tempokontraste lassen dabei zuweilen an die opernhaftige Tonsprache eines Telemann oder Graupner denken.
6. Choral
Drum fahrt nur immer hin, ihr Eitelkeiten,
du, Jesu, du bist mein, und ich bin dein;
ich will mich von der Welt zu dir bereiten;
du sollst in meinem Herz und Munde sein.
Mein ganzes Leben
sei dir ergeben,
bis man mich einsten legt ins Grab hinein.
6. Choral
Der Schlusschoral, die wörtlich zitierte sechste Strophe des Fritsch-Liedes, formuliert eine ganz aufs Jenseits hin orientierte, persönliche Jesus-Mystik: «Ich will mich von der Welt zu dir bereiten», Jesus mit seinem ganzen Leben ergeben sein, «bis man mich einsten legt ins Grab hinein».
Nina Kunz
Können Sie mir bitte sagen, wie ich leben soll?
Ein Input zur Kantate «Liebster Immanuel, Herzog der Frommen»
Vorbemerkung: Ich bin keine Expertin, was klassische Musik angeht. Daher bin ich nicht mit Wissen an diesen Text herangegangen, sondern mit freudiger Naivität. Ich habe mir das Stück immer wieder angehört und die dazugehörigen Zeilen vier, fünf, sechs, sieben Mal gelesen.
Ziemlich sicher bin ich nicht in der Lage, jede Schicht dieses Kunstwerks zu durchdringen. Aber in meinem Verständnis geht es in dieser Kantate um die Freude, dass mit Jesus nun ein Retter auf Erden ist, nach dem man seinen inneren Kompass ausrichten kann.
Das hat mich dazu inspiriert, über den Wunsch nach Sicherheit, Geborgenheit und Richtung in einer überfordernden Welt nachzudenken.
Mein Input geht wie folgt:
Es kommt immer wieder vor, dass ich nachts wachliege. Das hat einerseits damit zu tun, dass es seit Monaten in mein Haus tropft. Der Dachdecker war schon dreimal da, aber er findet das Loch zwischen den Ziegeln, das es offenbar geben muss, einfach nicht. Daher tropft es, wenn es regnet, in unseren Dachstock hinein und mein Zimmer befindet sich leider direkt unter der Stelle, an der sich das Wasser sammelt.
Das klingt unspektakulär, ich weiss.
Aber Tropfen können erstaunlich laut werden, wenn sie zweieinhalb Meter in die Tiefe fallen. Tack. Tack. Tack. Das Geräusch macht mich inzwischen halb wahnsinnig.
Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, warum ich oft nicht schlafen kann. Und der hat damit zu tun, dass ich dazu neige, in der Dunkelheit über grosse und kleine Fragen nachzudenken; und diese Fragen können in meinem Kopf so gross werden, dass ich kaum glauben kann, dass so viel Grübelei in einem präfrontalen Kortex – oder wo auch immer die Grübelei passiert – Platz hat.
Nur in der letzten Woche habe ich mich in der Dunkelheit zum Beispiel folgende Dinge gefragt: Bin ich glücklich? Bin ich glücklich als Autorin oder sollte ich nochmals eine Ausbildung machen und Sozialarbeiterin werden? Sollte ich in Zürich alt werden oder in Berlin? Will ich Mutter werden oder kann es sein, dass ich tatsächlich keinen Kinderwunsch habe? Werde ich es bereuen, wenn ich keine Kinder habe? Soll ich mich gegen Humane Papillomviren impfen lassen? Will ich den Fokus in meinem Leben auf romantische Beziehungen legen oder auf Freundschaften? Und: Ist es in unserer krisenhaften Welt überhaupt noch legitim, über privates Glück nachzudenken?
Wenn ich jeweils so wachliege und nachdenke, dann kommt es auch oft vor, dass ich mich dumm oder schlecht fühle. Dumm fühle ich mich, weil ich ab und zu dazu neige, so viel über die Frage «Wie will ich leben?» nachzudenken, dass ich vergesse, einfach mal ein bisschen zu leben. Und schlecht fühle ich mich, weil ich ja im Grunde weiss, dass es ein riesiges Privileg ist, so viel Autonomie zu haben und aus einem so breiten Angebot an Lebensmodellen etwas für mich heraussuchen zu dürfen.
In diesen Momenten denke ich fast immer an meine Grossmutter. Denn sie erzählt mir immer wieder, dass sie als junge Frau Medizin studieren und Ärztin werden wollte. Das war ihr Traum. Aber leider wurde ihr gesagt: Mädchen seien für diese Karriere nicht geeignet. Also wurde sie Laborantin.
Zudem wurde von ihr – wie sie mir erzählt – auch noch erwartet, dass sie heiratet, Kinder bekommt und den Haushalt macht. Sie hatte nicht halb so viele Freiheiten wie ich. Daher will ich mich nicht beklagen. Mir ist bewusst, wie unverschämt gut ich es habe.
Was ich sagen will, ist also: Wenn ich in der Nacht wachliege, dann frage ich mich auch häufig, warum ich mich – trotz all dieser Freiheiten und dieser Privilegien, welche die Generationen vor mir erkämpft haben – manchmal so schlecht fühle. Warum da dieses Zwicken im Bauch ist und dieses Kribbeln in den Fingern und diese Ratlosigkeit und diese Rastlosigkeit. Und ehrlich gesagt weiss ich nicht, ob ich schon die passendsten, die präzisesten Worte dafür habe. Aber ich glaube, dass dieses Gefühl viel damit zu tun hat, dass ich von mir selbst erwarte, ein möglichst optimales Leben zu führen. Ich will, und das ist das Allerwichtigste, meine begrenzte Zeit auf Erden auf keinen Fall verschwenden.
Woher ich die Idee habe, dass man seine Zeit überhaupt verschwenden kann, oder was ich genau unter «Zeit verschwenden» verstehe, weiss ich nicht. Doch ich denke, dass ich unter anderem mit dem Imperativ aufgewachsen bin, dass man das Bestmögliche aus sich und seinen Talenten herausholen soll. Sonst hat man versagt. Und manchmal empfinde ich, so könnte man es vielleicht zugespitzt formulieren, eine Art Zwang, sich selbst als grossartiges Individuum zu erschaffen. Und das erzeugt Druck.
Zudem habe ich bei der britischen Journalistin Pandora Sykes mal gelesen, dass wir heute in einer Welt leben, in der von uns erwartet wird, dass wir uns selbst so gut kennen, dass wir in der Lage sind, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen, die uns auf dem Weg zu einem optimalen Leben weiterbringen. Und bei der Soziologin Eva Illouz habe ich folgenden Satz gelesen: «Glück gilt in unseren Zeiten als eine Geisteshaltung, die sich willentlich herbeiführen lässt, als Resultat der Mobilisierung unserer inneren Stärke und unseres ‹wahren Selbst›.»
Auf jeden Fall liege ich nachts oft wach, weil mich einerseits diese Freiheiten – in Bezug auf Lebensentwürfe, Ideologien und Hobbys – überfordern. Und anderseits liege ich wach, weil es mit dieser Selbsterkenntnis nicht so richtig klappt: Ich weiss nicht immer, was ich wollen soll. Ich weiss nicht immer, was mir guttut oder was ich in Zukunft bereuen werde und was nicht.
Oder nochmals anders gesagt: Was mich aufgrund all dieser Dinge schon seit langer Zeit plagt, ist diese grosse Angst, mich im Leben falsch zu entscheiden. Ich fürchte fast nichts mehr, als dass ich verkehrt abbiegen und in einer Sackgasse landen könnte. Ich habe Angst, «es» nicht richtig zu machen, und mit «es» meine ich: das Leben.
Wenn ich so daliege und es Mitternacht wird oder halb eins, dann verspüre ich manchmal diesen tiefen Wunsch, dass mir jemand sagt, was richtig ist und was falsch. Ich stelle mir keine Prophetin vor und auch keinen Engel. Ich male mir eher aus, dass es so was wie eine Stimme in mir drin gibt, die mir Ratschläge erteilt. Die mir sagt, was sinnvoll ist und was nicht, was cool ist und was nicht, was korrekt ist und was ich lieber lassen soll.
Und ja: Wenn ich mir das so vorstelle, dann komme ich mir wieder maximal blöd vor. Denn – wie gesagt – ich habe alle diese Freiheiten und dann wünsche ich mir, dass jemand kommt und Regeln für mich aufstellt. Geht’s noch?
Tröstlich finde ich im Grunde nur, dass ich mit diesem Wunsch offenbar nicht allein bin. Denn zumindest die britische Autorin und Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge hat in ihrem Theaterstück «Fleabag», in dem es um eine orientierungslose Frau in ihren Dreissigern geht, einen Monolog geschrieben, der weltberühmt wurde, als die Serie dann verfilmt wurde.
Sinngemäss übersetzt sagt die Protagonistin in dieser Szene, die übrigens in einer Kirche spielt: «Ich will, dass mir jemand sagt, was ich essen soll. Was ich mögen, hassen, worüber ich wütend sein soll, was ich hören, was für Bands ich mögen, wofür ich Tickets kaufen, worüber ich Witze, worüber ich keine Witze machen soll.»
Wenn ich an diesem Punkt immer noch wachliege, dann denke ich – und Achtung, jetzt werden die Gedankensprünge noch grösser – manchmal auch an den Psychologen Barry Schwartz. Der hilft zwar nicht beim Einschlafen. Aber er hat einen Begriff geprägt, der mich sehr beschäftigt. Der Begriff heisst «Paradox of Choice» und damit meint Schwartz, dass in unseren westlichen Gesellschaften häufig so viel Überfluss herrscht, dass es unsinnig wird. Ich selbst kann in meinem Alltag zum Beispiel zwischen (gefühlt) 75 Müesli-Sorten und 1943 Netflix-Serien aussuchen. Und diese grosse Auswahl macht nicht, dass ich mich freier fühle, sondern – und das ist eben das Paradox – eingeengter.
Vielleicht, so denke ich dann, hat meine Überforderung mit Entscheidungen also auch damit zu tun, dass ich in einem seltsamen Stadium des Kapitalismus lebe und die ganze Zeit zwischen so vielen Dingen und Büchern und Adidas-Hosen und Apple-Plus- und SRF- und HBO- und Disney- und Paramount-Serien und Versicherungsplänen und Ferien und Fensterputzmittelmarken aussuchen muss, dass mir permanent etwas schwindelig ist und ich vergesse, dass viele Optionen nicht dasselbe bedeutet wie Freiheit – und dann habe ich sowieso keine Energie mehr, um mir zu überlegen, wie ich tatsächlich leben will.
Aber wie gesagt: Wenn ich diese Gedanken denke, ist es schon wirklich spät, mein rechter Arm ist eingeschlafen und mein Nacken zwickt, weil ich in einer seltsamen Position daliege.
Es kann – und das ist leider kein Witz – allerdings auch vorkommen, dass ich sogar diesen Punkt überschreite, und dann beginne ich über Dinge wie den Freiheitsbegriff an und für sich nachzudenken – und das ist allgemein keine einfache Sache, aber morgens um drei Uhr wirklich nicht die beste Idee.
In der Regel kommt mir dann als Erstes Jean-Paul Sartre in den Sinn und ich überlege zum Beispiel, dass ich es immer tröstlich fand, was Sartre über das Menschsein sagte. Denn wenn ich mich nicht täusche, meinte Sartre eben, dass es keinen vorbestimmten Zweck gebe für die menschliche Existenz und das unterscheide uns – zum Beispiel – von einem Hammer.
Das hört sich zwar ein wenig abstrus an, aber ich glaube, er verstand darunter Folgendes: Wenn man einen Hammer herstellt, tut man das mit der Idee, dass man ein Werkzeug braucht, um etwa einen Nagel in die Wand zu hauen. Bei uns Menschen gibt es diesen Zweck hingegen nicht. Wir müssen jeden Tag – mit jeder Handlung, jeder Entscheidung – selbst definieren, was es heisst, ein Mensch zu sein. Und genau darin liegt die existenzielle Freiheit, die eine Bürde und ein Geschenk zugleich ist.
Und ja: Wenn ich solche Gedanken denke, bin ich meist schon etwas schläfrig oder in einem Zustand, der in die Richtung von «Halluzinieren» geht. Aber trotzdem fühle ich mich einigermassen wohl, denn spätestens jetzt kommt mir meine Überforderung mit Entscheidungen und dem Leben allgemein legitim vor. Denn: Wenn wir jeden Tag selbst entscheiden müssen, was es heisst, ein Mensch zu sein, und was für uns der Sinn des Lebens ist, dann ist das doch einfach viel verlangt und es scheint mir nichts als logisch, dass ich aufgrund dieser Verantwortung manchmal erschaudere und erstarre.
Wenn ich so daliege, denke ich ausserdem, dass ich vielleicht gar keine Prophetin oder Stimme brauche, nach der ich meinen inneren Kompass ausrichten kann. Wobei – sicher bin ich mir natürlich nicht. Aber ich frage mich einfach, ob nicht auch das Zweifeln selbst eine Art Richtung vorgeben kann.
Denn: Die ewigen Fragen begleiten mich schon lange. Das Grübeln ist so was wie mein treuester Weggefährte. Und das Rattern in meinem Kopf bringt mich dazu, in Bewegung zu bleiben und eine Art Wachsamkeit zu pflegen. Und das hat doch auch was Schönes.
Auf jeden Fall höre ich spätestens dann die Vögel zwitschern.
Vielleicht bin ich aber auch einfach nur eingeschlafen.