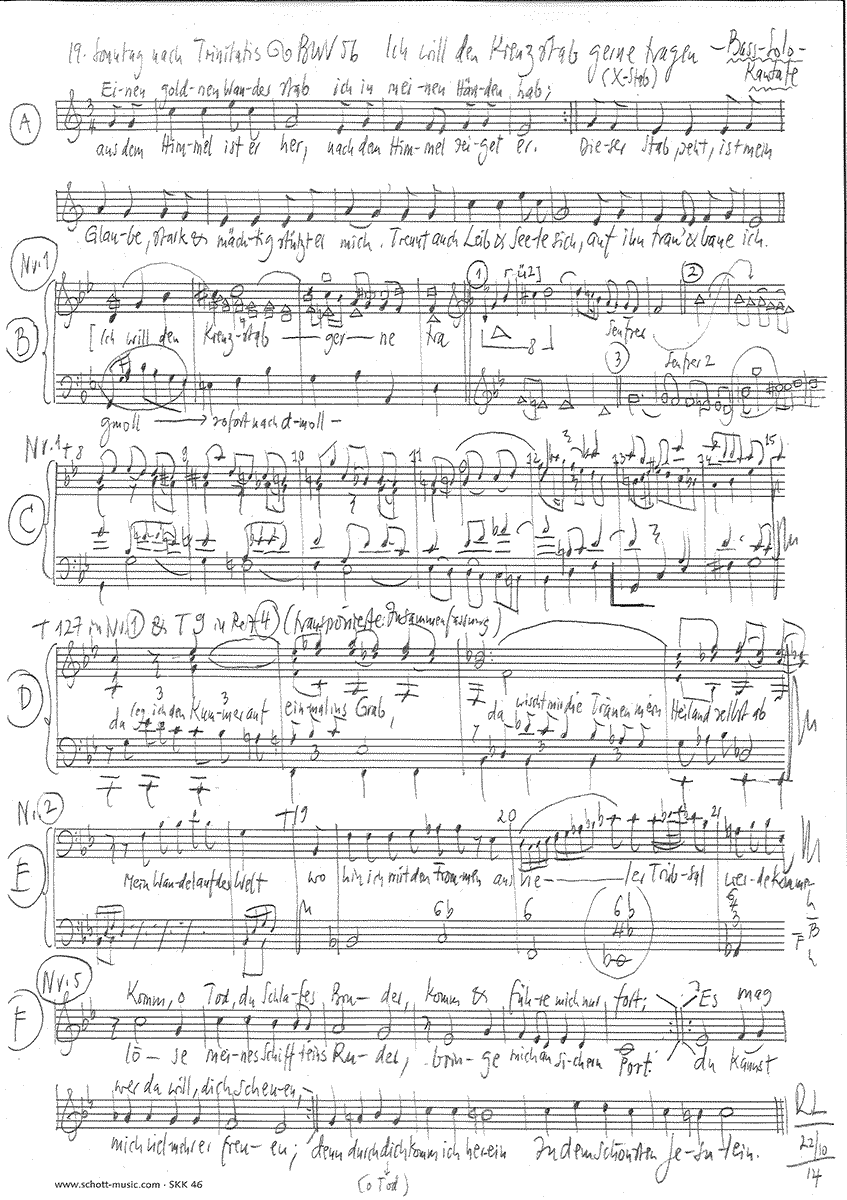Ich will den Kreuzstab gerne tragen
BWV 056 // zum 19. Sonntag nach Trinitatis
für Bass, Vokalensemble, Oboe I+II, Taille, Violoncello, Streicher und Basso Continuo
Die Kantate «Ich will den Kreuzstab gerne tragen» wurde zum 19. Sonntag nach Trinitatis 1726 komponiert. Ihr lange unbekannter Textdichter war neueren Forschungen zufolge der Nürnberger Theologe Christoph Birkmann (1703–1771), der während seiner Leipziger Studienzeit zu Bachs Schülerkreis gehörte und für den Thomaskantor offenbar etliche Libretti von erstaunlicher Sprachfertigkeit verfasste.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...
Werkeinführung
Reflexion
Bonusmaterial
Solisten
Bass
Klaus Mertens
Chor
Sopran
Lia Andres
Alt/Altus
Alexandra Rawohl
Tenor
Clemens Flämig
Orchester
Leitung
Rudolf Lutz
Violine
Plamena Nikitassova, Dorothee Mühleisen, Peter Barczi, Christine Baumann, Eva Borhi, Ildiko Sajgo
Viola
Sarah Krone, Christoph Riedo
Violoncello
Maya Amrein, Hristo Kouzmanov
Violone
Iris Finkbeiner
Oboe
Katharina Arfken, Thomas Meraner
Taille
Philipp Wagner
Fagott
Susann Landert
Orgel
Nicola Cumer
Musikal. Leitung & Dirigent
Rudolf Lutz
Werkeinführung
Mitwirkende
Karl Graf, Rudolf Lutz
Reflexion
Referent
Oswald Oelz
Aufnahme & Bearbeitung
Aufnahmedatum
24.10.2014
Aufnahmeort
Trogen
Tonmeister
Stefan Ritzenthaler
Regie
Meinrad Keel
Produktionsleitung
Johannes Widmer
Produktion
GALLUS MEDIA AG, Schweiz
Produzentin
J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz
Textdichter
Textdichter Nr. 1-4
Christoph Birkmann
Textdichter Nr. 5
Johann Franck
Erste Aufführung
19. Sonntag nach Trinitatis,
27. Oktober 1726
Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk
Die Eingangsarie mit ihrem energisch vom Continuo angeschobenen und in absteigende Seufzer übergehenden Kopfmotiv bleibt unmittelbar im Gedächtnis haften. Der zugleich schwerblütige wie federnde Orchestersatz umhüllt und trägt die Singstimme, die sich in zwei grossen Textanläufen zum verstehenden Bejahen des eigenen Leides und zur Erkenntnis der menschlichen Endlichkeit vortastet. Wie Bach zu den Worten «er führet mich» sinnfällig die Seufzer des Beginns in eine aufsteigende Bewegung umdeutet, ist ebenso meisterlich wie das plötzliche musikalische Aufatmen, das mit der Herkunft aller «Plagen» aus «Gottes lieber Hand» verknüpft ist. Dieses Ringen von Heilserwartung und Schmerzempfinden löst sich schliesslich in einer triolischen Bewegung auf, mit welcher der Solobass seiner Hoffnung Ausdruck verleiht, dass der Heiland selbst ihm bald jene Tränen abwischen wird, denen Bach in einer herzzerreissenden Schlusswendung Gestalt gegeben hat.
Das ganz vom Gedanken einer zugleich wellenumtosten wie behüteten «Schifffahrt» geprägte Rezitativ gehört zu den berührendsten Inventionen Bachs, der mit einer in Akkordbrechungen kreisenden Cellopartie das maritime Bild seines Librettisten optimal zum Leben erweckt. Dies gilt insbesondere für den Schluss, in dem Bach das Ende der Fahrt in einer Geste musikalischer Entschleunigung fasst, aus der heraus der Solist entschlossen ans Gestade seiner himmlischen Stadt hinübertritt – nicht ohne die überwundene «viele Trübsal» in einer letzten Lauffigur mit dissonantem Zielton nochmals in Erinnerung zu rufen.
Darauf folgt mit der Arie Nummer 3 eine gelöste Meditation über die Erlösung von allen Plagen, die Bach als Trio aus federndem Continuo, munterer Oboenkantilene und befreit aussingendem Solobass angelegt hat. Grundaffekt des Satzes ist vor allem im rahmenden A-Teil nicht triumphierende Auferstehungsfreude, sondern erleichterte Dankbarkeit und Vorfreude; dass das ganze Leben als lästiges «Joch» dargestellt wird, lässt hinsichtlich der barocken Weltsicht tief blicken. Im robusteren Mittelteil wird dann gegen alle menschliche Wahrnehmung das Sterben nicht als Schwinden der Kräfte gedeutet, sondern als auf Adlerschwingen errungener Eintritt in ein höheres Dasein gefeiert.
Das Rezitativ «Ich stehe fertig und bereit» kündet in reichem Accompagnato-Satz und feierlichem Tonfall von der Entschlossenheit, alles irdische Elend zugunsten des himmlischen Erbteils hinter sich zu lassen. Mit der sowohl semantisch wie formal überzeugenden Wiederaufnahme der bereits die Eingangsarie abschliessenden Triolenfigur erschafft der Komponist einen einprägsamen Spannungsbogen, der das kurze Orchesternachspiel wie eine visionäre Rekapitulation des verflossenen Lebenslaufs erscheinen lässt.
«Komm, o Tod, du Schlafes Bruder» – mit dieser Strophe aus Johann Francks Lied «Du, o schönes Weltgebäude» (1653) ist der Kantate ein Choralsatz in c-Moll angefügt, der trotz seiner äusserlichen Schlichtheit zu Bachs berühmtesten Schöpfungen gehört und weit über die Musik hinaus in Literatur und Kunst zum zitierfähigen Topos wurde. Die tiefe Lage des Satzes und die wundersamen Rückungen zwischen den Zeilen verleihen dem Gesang melancholische Ruhe und Kraft. Umso bemerkenswerter wirkt so die abschliessende Öffnung des Klangraumes, die die Begegnung mit einem Jesus beschreibt, der hier väterlicher Freund und Krippenkind zugleich sein darf.
Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen
Der Text geht vom Sonntagsevangelium von der Heilung des Gichtbrüchigen aus Matthäus 9 aus. Der Dichter erwähnt die Heilung nicht ausdrücklich, sieht aber im Gichtbrüchigen ein Bild für den Christen, der auf seinem Lebensweg «sein Kreuz» auf sich nimmt und auf Christus vertraut. Die biblisch passende Einbeziehung von Seefahrtsmetaphern erwies sich für Bachs Vertonung als besonders glückliche Vorlage.
1. Arie
Ich will den Kreuzstab gerne tragen,
er kömmt von Gottes lieber Hand.
Der führet mich nach meinen Plagen
zu Gott in das gelobte Land.
Da leg ich den Kummer auf einmal ins Grab,
da wischt mir die Tränen mein Heiland selbst ab.
1. Arie
Das Kreuz ist ein vielseitiges Symbol. Mit dem Kreuzstab ist ein langer Stab mit einem kurzen Querholz gemeint. Man trug es in Prozessionen mit zum Zeichen, Christus im Leiden nachzufolgen. Der Dichter denkt dabei auch an den Stab des guten Hirten, der die Seinen auf rechtem Pfade führt (Psalm 23), oder an den Stab des Mose, der das Volk ins «gelobte Land», die ewige Heimat bringt (Exodus 17, 9). Bach entwirft dafür eine reiche dunkle Klanglichkeit, in deren dichtem Satz eine markant aufsteigende Figur (mit hörbarem «Kreuz» als Intervallziel und Umkehrpunkt) sowie eine absteigende Seufzerkette beständig miteinander verwoben sind. Damit sind sowohl die Entschlossenheit, das Kreuz zu tragen, wie die Last des damit verbundenen Weges musikalisch präsent. Die edle Kantilene des Basses geht zu den letzten beiden Zeilen in eine sehnsuchtsvolle Triolenbewegung über.
2. Rezitativ
Mein Wandel auf der Welt
ist einer Schifffahrt gleich:
Betrübnis, Kreuz und Not
sind Wellen, welche mich bedecken
und auf den Tod
mich täglich schrecken;
mein Anker aber, der mich hält,
ist die Barmherzigkeit,
womit mein Gott mich oft erfreut.
Der rufet so zu mir:
Ich bin bei dir,
ich will dich nicht verlassen noch versäumen!
Und wenn das wütenvolle Schäumen
sein Ende hat,
so tret ich aus dem Schiff in meine Stadt,
die ist das Himmelreich,
wohin ich mit den Frommen
aus vieler Trübsal werde kommen.
2. Rezitativ
Am Anfang des Berichtes aus dem Evangelium heisst es: «Und er stieg in ein Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt» (Kapernaum). Dies lässt den Dichter unsern «Wandel auf der Welt» mit einer Schifffahrt vergleichen, die durch Sturm und Wellen geht, aber «in meine Stadt, die ist das Himmelreich» führt. Der Anker (Kreuzsymbol der Hoffnung) ist die Barmherzigkeit des Gottes, der nicht im Stich lässt, wer ihm vertraut. Über haltgebenden Continuotönen hat Bach eine ausdrucksstarke Arioso-Singstimme gesetzt, die von weit ausgreifenden Akkordbrechungen des Violoncello umspielt werden. Diese unablässige Wellenbewegung beruhigt sich in sinnfälliger Weise, sobald von der Ankunft im Himmelreich gesprochen wird. Dass sämtliche Stimmen im tiefen Klangbereich verbleiben, könnte – anders bei einem rauschenden Orchestersatz – darauf deuten, dass die «Schiffahrts-Metapher» einen inneren Erfahrungsprozess meint.
3. Arie
Endlich, endlich wird mein Joch
wieder von mir weichen müssen.
Da krieg ich in dem Herren Kraft,
da hab ich Adlers Eigenschaft,
da fahr ich auf von dieser Erden
und laufe, sonder matt zu werden.
O gescheh es heute noch!
3. Arie
Am Ende wird den Nachfolgern Christi das Joch, das sie getragen haben, abgenommen. Es wird sich erfüllen, was in Jesaja 40, 31 versprochen ist und in den Zeilen 3 bis 6 der Arie fast wörtlich zitiert wird. Die gesamte Motivik der Arie ist von drängender Bewegung und dem Gefühl geprägt, «endlich!» dem Ziel allen Wandelns nahe zu sein. Ein laufender Continuobass begleitet ausgedehnte Koloraturen der Singstimme und Oboe. Der Austausch kurzer Motive beschreibt die ermutigende Zusage, sich bald wie ein «Adler» aus dem irdischen Jammertal aufschwingen zu können, hat im Abreissen der Linien («weichen müssen») aber auch textdeutende Funktion.
4. Rezitativ
Ich stehe fertig und bereit,
das Erbe meiner Seligkeit
mit Sehnen und Verlangen
von Jesus Händen zu empfangen.
Wie wohl wird mir geschehn,
wenn ich den Port der Ruhe werde sehn:
Da leg ich den Kummer auf einmal ins Grab,
da wischt mir die Tränen mein Heiland selbst ab.
4. Rezitativ
Der Dichter nimmt das Bild von der Schifffahrt wieder auf: Er ist «fertig», d. h. zur Fahrt bereit. Es geht Jesus entgegen, nach der stürmischen Fahrt zum «Port der Ruhe». Der zugefügte Streichersatz verleiht dieser Aussage einen feierlichen Ton und wirkt wie ein schimmerndes Festgewand für diesen Moment des Übergangs. Bachs Idee, an dieser Stelle die beiden letzten Verse der Eingangsarie auch musikalisch wieder aufzugreifen, kann nur als genial bezeichnet werden. Der weite Stimmumfang und gehobene Tonfall gerade auch dieses Rezitativs deuten auf einen befähigten Sänger, in dem Hans-Joachim Schulze den Universitätsstudenten und späteren Merseburger Hofmusiker Johann Christoph Samuel Lipsius vermutet hat.
5. Choral
Komm, o Tod, du Schlafes Bruder,
komm und führe mich nur fort;
löse meines Schiffleins Ruder,
bringe mich an sichern Port.
Es mag, wer da will, dich scheuen,
du kannst mich vielmehr erfreuen;
denn durch dich komm ich herein
zu dem schönsten Jesulein.
5. Choral
Die Liedstrophe von Johann Franck fasst aufs schönste zusammen: Vor dem Tod, des «Schlafes Bruder» fürchtet er sich nicht, denn dieser bringt das Lebensschifflein in den sicheren Hafen zu Jesus, dem Erlöser. «Jesulein» wird in der Sprache des Barock nicht nur das Jesuskind in der Krippe, sondern ganz allgemein der geliebte Christus genannt. Der zugleich zurückhaltende wie eindringliche c-Moll-Satz gehört mit seiner meisterlichen Stimmführung und entrückten Klanglichkeit zu Bachs bekanntesten und berührendsten Choralvertonungen.
Oswald Oelz
Erfüllendes Leiden und erlösender Tod
Der Text des unbekannten Dichters der Kantate «Ich will den Kreuzstab gerne tragen» erscheint auf den ersten Blick überholt; er widerspricht dem Zeitgeist – zumindest jenem, der in unserem Teil der Welt zu herrschen scheint, der ja immer noch vom Glück gesalbt ist. Die Heilung von Gichtbrüchigen, die im entsprechenden Sonntagsevangelium aus Matthäus 9 beschrieben wird, bedarf heute keiner göttlichen Wunder, sondern einiger Pillen aus Basel.
Tatsächlich sprechen mich zwei Aspekte im Text der Kantate «Ich will den Kreuzstab gerne tragen» seit langem besonders an: Zum einen die schon fast freudige Bereitschaft, sein Kreuz, den Schmerz und die Mühsal des Lebens zu ertragen. Zum anderen die Gelassenheit und Ruhe, Schlafes Bruder anzunehmen in der Zuversicht, in einem sicheren Hafen zu enden.
Die Bereitschaft, die Mühsal des Leben zu ertragen, das heisst zu leiden, ist nicht modern. Die Mühsal körperlicher Arbeit ist zu einem guten Teil von den Maschinen übernommen worden. Treppen steigen ist nicht mehr nötig, seitdem es Rolltreppen und Lifte gibt, Äpfel und Birnen aufzulesen lohnt sich nicht, sie verfaulen am Boden. Kopf, Rücken oder Monatsschmerzen lassen sich behandeln, und für die unerträglichen Knochenschmerzen eines Karzinoms gibt es Operation, Strahlen, palliative Chemotherapie und schliesslich Morphin.
Auch seelischer Schmerz, Depression und selbst Trauer und Verlust lassen sich mildern, sei es mit Hilfe von Serotoninantagonisten oder mittels Betreuungsteams. Wie häufig hören oder lesen wir doch nach grossen Unglücken in den Medien die Stereotypie: «die Angehörigen/Überlebenden des Unglücks werden psychisch betreut».
Wir leben in einer idealen schmerzarmen Welt, das Tal der Leiden ist durchschritten, Florestan steht wieder im Sonnenlicht und hält seine Liebste im Arm. Aber in einigen von uns ist da etwas, das nicht mitmacht. Die mit dem Silberlöffel im Mund Geborenen bevölkern die Praxen der Psychotherapeuten, verfallen allerlei Drogen, lassen sich aus peitschen und, begehen, wenn es ganz schlimm wird, Selbstmord. Andere ziehen das Mönchsgewand an, verinnerlichen sich durch Fastenkuren, Yoga oder Ersteigen von Matterhorn und Achttausendern. Manche haben gemerkt, dass, was allzu leicht in den Schoss fällt, nicht wertvoll ist und nicht geschätzt wird. Wirklich Wertvolles muss erlitten werden. Goethe schreibt «leidend lernte ich viel» und bei Kierkegaard erfahren wir, dass die Wahrheit nur durch Leiden siegt. Von Schopenhauer und Nietzsche lernen wir, dass der Grad und die Fähigkeit zu leiden den Massstab für den individuellen Rang darstellen. Und Joseph Beuys erklärte: «Es wäre eine grosse Frage, wer die Welt mehr bereichert: die Aktiven oder diejenigen, die leiden? Ich habe ja immer entschieden: die Leidenden. Der Aktive mag Menschliches für die Welt erreichen. Aber ein krankes Kind, das sein Leben lang im Bett liegt und gar nichts tun kann, leidet und erfüllt durch sein Leid die Welt mit christlicher Substanz.»
Die christliche Substanz, wie Christus sie verstand.
Beim einfachen, mir naheliegenden Beispiel des Bergsteigens ist das ganz offensichtlich: wer sich unbeeindruckt von Schmerz und Atemnot im Spiel der Leiden höher quälen kann, erreicht schliesslich seinen persönlichen Endpunkt. Deshalb ist mir dieser Kantatentext als ewig kreisende Botschaft vor einigen Jahren bei der Durchsteigung einer grossen Wand im Oman durch den Kopf gegangen und hat mich nicht mehr los gelassen. Ich hatte den Kreuzstab in Form eines schweren Rucksacks auf meinem Rücken, der Sängerin meinem Kopf versicherte, dass diese Last «von Gottes lieber Hand» komme. Als wir schliesslich nach zwei Tagen ausgetrocknet und mit blutigen Händen den Gipfel, unseren Hafen, erreichten, waren wir glücklich wie selten zuvor.
Nicht anders ist es beim Marathon-Lauf: ab Kilometer Dreissig beginnt der Kreuzweg. Füsse, Knie, Hüfte und Rücken schmerzen. Der Titel einer anderen Bach Kantate geht einem durch den Kopf: «Ich habe genung» (BWV 82). Das Laufen und die Qual sind völlig sinnlos und müssen trotzdem durchgestanden werden. Am Ende der Schiffahrt wartet dann das gelobte Land, das Himmelreich, nicht mehr laufen zu müssen. Wie zufrieden wir aber in diesem Himmelreich sind, und wie lange wir es dort aushalten, ist eine andere Frage. Ich habe meine Zweifel, ob das Schiff lange im Hafen bleiben wird.
Ultimatives Leiden ist der Tod, die Endlichkeit
Das zweite, mir wichtige Thema der Kantate «Ich will den Kreuzstab gerne tragen» ist der von Johann Franck verfasste Schlusschoral «Komm, o Tod, du Schlafes Bruder», also die freudige Erwartung des Jenseits, die schönste Beschreibung der Ars Moriendi. Immer wenn ich diesen Choral höre, muss ich an die Bach-Kantate «Wer weiß, wie nahe mir mein Ende» (BWV 27) mit der Arie «Willkommen, will ich sagen,/wenn der Tod ans Bette tritt» denken. Auch in unserer säkularen Zeit, in der alles in einer kurzen Spanne erlebt und bewältigt werden muss, bleibt der Tod der wahre Schauspieldirektor des Lebens. Dagegen wird mit Fitnessprogrammen, Verzicht auf Butter, Cholesterinsenkern und Chemie, ein schon primär aussichtsloser Kampf geführt. Für die geringste Fristenerstreckung wird viel Geld ausgegeben, eingebaute Defibrillatoren sollen den plötzlichen Herztod verhindern, denn das Leben ist ja heute der Güter höchstes – im Unterschied zu Schillers Meinung, dass das eben nicht so sei. Sich aber täglich bewusst zu werden, dass man bald einmal sterben wird, ist die beste Lebenshilfe. Fast alle Erwartungen von aussen, aller Stolz, alle Angst vor Peinlichkeit oder Versagen fallen im Angesicht des Todes einfach ab. Nur das, was wirklich zählt, bleibt. Und das sind die Spuren, die wir in unserer Umwelt hinterlassen haben. Mögen sie gut sein, wie jene von Johann Sebastian Bach und Mozart oder eben schrecklich wie die von Hitler und Stalin oder anderer Scheusale der Geschichte.
Ältere Menschen sollten deshalb Bilanz ziehen. Ich hoffe immer, dass ältere Menschen das gleiche Glück wie jener Mann in einer von Bertold Brechts Erzählungen haben: er stand im November im New Yorker Schneetreiben und bat Vorübergehende um ein Nachtlager für einen der vielen Homeless people in den Strassen, und manchmal war er erfolgreich. Er schloss dann daraus, dass das die Welt zwar nicht verändert habe, aber manche dieser Heimatlosen für eine Nacht ein Dach über dem Kopf hätten und nicht nass würden. Manchmal werden Strassen nach Menschen benannt, und in fünfzig Jah ren weiss niemand mehr, wer der Namensgeber war. Sinnvoller erscheint es mir da, für die Dächer über den Köpfen der Verlorenen zu sorgen.
Persönlich bin ich durch das Stahlbad des katholischen Katechismus gegangen und weiss nach der Überwindung dieses Fegefeuer und Höllenängsteterrors – du sollst / du sollst nicht – nicht, was nach meinem kurzen Aufglühen sein wird. Wir leben ja gemäss Vorstellung der Teilchenphysiker in einem Polyversum, das aus Trillionen von Universen besteht. Immerhin relativiert das die anthropozentrische Sicht auf unsere Existenz. So wissen wir ja auch nicht, was Milliarden von Menschen erlebt haben, als sie vor uns den Weg ins unbekannte Land angetreten haben. Ich allerdings glaube zu wissen, dass es einigen meiner Patienten besser gegangen ist, nachdem sie sich von mir haben behandeln lassen.
Und so verbleibt mein Trost bei den Versen des Gedichts «Aus Fernen, aus Reichen», die der Pastorensohn Gottfried Benn, geschrieben hat:
«Was dann nach jener Stunde
sein wird, wenn dies geschah,
weiß niemand, keine Kunde
kam je von da,
von den erstickten Schlünden,
von dem gebrochnen Licht,
wird es sich neu entzünden,
ich meine nicht.
Doch sehe ich ein Zeichen:
über das Schattenland
aus Fernen, aus Reichen
eine große, schöne Hand,
die wird mich nicht berühren,
das läßt der Raum nicht zu:
doch werde ich sie spüren
und das bist du.
Und du wirst niedergleiten
am Strand, am Meer,
aus Fernen, aus Weiten:
«– erlöst auch er»;
ich kannte deine Blicke
und in des tiefsten Schoß
sammelst du unsere Glücke,
den Traum, das Loos.
Ein Tag ist zu Ende,
die Reifen fortgebracht,
dann spielen noch zwei Hände
das Lied der Nacht,
vom Zimmer, wo die Tasten
den dunklen Laut verwehn,
sieht man das Meer und die Masten
hoch nach Norden gehn.
Wenn die Nacht wird weichen,
wenn der Tag begann,
trägst du Zeichen,
die niemand deuten kann,
geheime Male
von fernen Stunden krank
und leerst die Schale,
aus der ich vor dir trank.»
Ich erinnere mich, wie Gottfried Benn an einen Vortrag auf einen Einwand eines Zuhörers sarkastisch antwortete: «eine höhere Wahrheit aus Ihrem Munde, was soll denn das nun wieder?» Wie könnte Benns ästhetische Zerrissenheit besser zum Ausdruck kommen als in dem Vers «– erlöst auch er», dessen Hoffnungsschimmer im scharfen Kontrast zum Befund des Nichts steht.
So bekommen denn auch die Schlussverse aus Benns 5. Gedicht von «Epilog 1949» ihren Sinn:
«Die vielen Dinge, die du tief versiegelt
durch deine Tage trägst mit dir allein,
die du auch im Gespräche nie entriegelt
in keinem Brief und Blick sie ließest ein.
Die schweigenden, die guten und die bösen,
die so erlittenen, darin du gehst,
die kannst du erst in jener Sphäre lösen,
in der du stirbst und endend auferstehst.»
Mehr als nur das Nachglühen, mehr als der Strassenname oder ein Grab «der guten und der bösen», die doch alle aus der Erinnerung verschwinden, scheinen das Ungesagte, aber auch das Vergessene, wie der unbekannte Dichter der Kantate, die Zeiten überdauern und immer wieder kommen zu wollen.